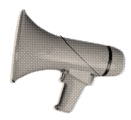Corona ist kein externer Schock
These 1: Corona ist kein externer Schock
Corona als „externen Schock“ zu verstehen ist das Herzstück der ideologischen Bearbeitungen der Pandemie. Wir sehen dies in Regierungserklärungen und in der Tagespresse ebenso wie in den ökonomietheoretischen Analysen des mainstreams. Die Grunderzählung lautet, dass Corona mit dem eigentlichen (gern auch als „normal“ bezeichneten) Funktionieren „unserer Wirtschaft“ nichts zu tun habe. Die Pandemie erscheint vielmehr als ein Betriebsunfall, ein plötzliches und unerwartetes Ereignis, das „uns alle“ nun bedroht, und gegen das wir uns nun ordnungspolitisch zusammenzuschließen müssen, um den Angriff auf unseres (schönen?) normalen Lebens abzuwehren. Die zugespitzte Metapher dieses Denkens ist der Krieg: „Wir sind im Krieg mit dem Virus“, propagierte nicht nur Emmanuel Macron, die nationale Mobilmachung lancierend, während gewitzte Schreiberlinge rasch Bücher zu Die Welt im Corona-Krieg auf den Markt warfen.
Ökonomietheoretisch hat die Metapher vom externen Schock zwei Grundlagen: Die erste findet sich in der neoklassischen Wirtschaftstheorie in ihrem grundlegenden Verständnis von „Wirtschaft“ als geschlossenes System. Damit ist der Markt gemeint, auf dem die Waren zirkulieren sollen. Dieser Markt wird als „geschlossen“ konzipiert, um so das sog. Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage errechnen zu können. In der Tat ist das Fach „Wirtschaft“ oder „Volkswirtschaftslehre“ derzeit vor allem abstrakte Mathematik und das „geschlossene System“ ist die quantifizierte Modellistik, die bestimmte Parameter als Konstante setzt, um die entsprechenden Variabeln zu berechnen. Die zweite theoretische Linie ist die stärker politische und führt zum Neoliberalismus, nämlich zur Denkfigur des ordnungspolitisch autoritären, wehrhaften Staates. Es ist ein verbreitetes Missverständnis, Neoliberalismus mit Laissez-faire zu identifizieren. Vielmehr ist es im Neoliberalismus die wesentliche Aufgabe des Staates, die natürliche Ordnung des Marktes (Hayek) gegen jene durchzusetzen, die deren Überlegenheit nicht akzeptieren wollen (Ptak 2017). Das Außen, die externe Gefahr wird hier deutlich auch politisch-gesellschaftlich bestimmt: Nicht nur Donald Trump bezeichnete Corona als „chinesisches Virus“, und in der medialen Öffentlichkeit stand vor allem zu Beginn der Krise ein orientalisierend-exotischer Blick auf Lebend- und Wildtiermärkte in Wuhan im Vordergrund. Befremdliche kulturelle Essgewohnheiten, so die Message, verbunden mit den (dortigen) mangelnden Hygienestandards (untermalt mit Bildern, die Fliegen auf den Tierkörpern zeigen) haben uns das Virus eingebrockt.
In beiden theoretischen Linien (der neoklassischen und der neoliberalen) sind externe Schocks dann keineswegs singuläre, aber doch „unerwartete“ Ereignisse. Wirtschaft als ein eigentlich gut funktionierendes (geschlossenes) System wird also von außen gestört, mehr noch: angegriffen. Corona „infiziert unsere Wirtschaft“ war eine häufige mediale Formulierung, und als Steigerung wird Corona nicht nur in der Tagespresse verbreitet zum „Feind“. Corona ist hier nicht nur der zentrale Agent, der eigentliche Aktant, auf den Wirtschaft und Gesellschaft „reagieren“ müssen, sondern zudem ein von außen kommender, daher heimtückischer Angreifer und Aggressor. „Externe Schocks“ können aber neben dem Paradebeispiel Krieg auch Naturkatastrophen, soziale Revolten, einschneidende politische Maßnahmen (z.B. Eingriff in Eigentumsrechte) oder auch Marktturbulenzen, Ölpreis-„Schocks“ oder platzende Spekulationsblasen sein. Bereits an dieser Aufzählung wird deutlich: Das „Plötzliche“ und das „Externe“ machen sich an einem sehr spezifischen Standpunkt fest, nämlich am kapitalseitig als reibungslos angenommenen Verwertungsgeschehen.
These 2 Von der Rückkehr zur Normalität zum normalisierten Ausnahmezustand
Ein Verständnis der „unsere Wirtschaft“ bedrohenden externen Gefahr zielt politisch auf eine sozialtechnologische Krisenbearbeitung, die „die Wirtschaft“ möglichst wenig einschränkt, ihr vielmehr den Rücken stärkt. Schon früh hatten liberale Wirtschaftsvertreter gegen Lockdowns mobilisiert, und wirtschaftsnahe Medien forcierten eine Debatte darüber, dass „Menschenleben“ nicht per se über das „Wirtschaftsleben“ gestellt werden könnten. Mittlerweile hat sich für alle, die sich nicht ins Homeoffice verabschieden können, eine Bearbeitungsform der Pandemie durchgesetzt, die „Eigenverantwortung“ mit einem weitgehend ungeschützt fortgesetzten Produktions- und Arbeitsalltag verbindet. Hierbei ist die digitalisierte Erfassung und Kontrolle für das Gefahrenmanagement zentral (z. B. kurzfristig-flexible kleinräumige Einschließungen und Quarantäne-Maßnahmen). Diese digitalisierte Bevölkerungspolitik hat einen transnationalen Klassencharakter, wie beispielsweise die unverändert ungeschützte Unterbringung der (oft osteuropäischen) Arbeiter*innen in der Fleischindustrie und der Landwirtschaft in Deutschland zeigt.
In den offiziellen Debatten steht hierbei eine möglichst rasche Wiederherstellung eben jener „Normalität“ im Zentrum, die durch den (vermeintlich) äußeren Angriff in Turbulenzen geriet. Diese Normalität wird als eine des freudvollen Konsumierens beschworen. Wir alle werden in einem fort daran erinnert, wie froh wir sind bzw. sein werden, wenn die Geschäfte endlich wieder öffnen, wir wieder ins Kaffeehaus und endlich wieder in den Urlaub fliegen können. Die Rückkehr zur Normalität als triumphale Rückkehr in die Shopping-Malls konstruiert dabei jenes ökonomisch-nutzenmaximierend kaufende Menschenbild, das sich komplementär zum Verständnis von Ökonomie als Tausch- und Marktgeschehen verhält und dabei „sonstige“ Sozialbeziehungen und (Arbeits-)Praxen weitgehend ausblendet.
Allerdings: die propagierte Rückkehr zur Normalität ist zwieschlächtig. Denn der externe Schock ist zwar, wie skizziert, ein (vermeintlich) unvorhersehbares, aber eben kein singuläres Ereignis. Bei genauerer Betrachtung wird deshalb die propagierte Rückkehr zur Normalität - bei aller betonten Dringlichkeit – immer als eine vorläufige, eine fragile gezeichnet. Sie ist zugleich neue Normalität, in die kommende „überraschende“ Schocks bereits eingespeist sind. „Risiko“, auch für das menschliche Leben als solches, könne und müsse zwar bestmöglich „gemanaged“ werden, so heißt es von die „Wirtschaftsexperten“, aber Versprechungen in Richtung eines „umfassenden Lebensschutzes“ seien irreführend.
Diese diskurspolitische Zwieschlächtigkeit von der Rückkehr zur schönen Profit- und Konsum-Normalität, die aber dann doch gefahrenvoll bleibt, ist alles andere als harmlos. Vielmehr erleben wir seit geraumer Zeit eine Verabschiedung von vormaligen (staatlich-paternalistischen) Fortschrittsversprechungen, wonach es – wenigstens der Erzählung – nach, allen irgendwie künftig besser gehen soll und muss. Stattdessen erfolgt eine eng an den österreichischen Neoliberalen Friedrich August von Hayek angelehnte politische Ökonomie der radikalen Nichtgestaltbarkeit unseres sozioökonomischen Zusammenlebens. Hierzu kann man bei dem Neoliberalen Friedrich August von Hayek nachschlagen. Wirtschaft ist demnach nicht nur von (wiederkehrenden) externen Schocks bedroht, sondern sieht sich prinzipiell einer gefahrenvollen Umwelt gegenüber, in der und gegen die sie sich behaupten muss. Dem unhintergehbaren Lebensprinzip der Konkurrenz (Hayek nennt es Wettbewerb) haben sich alle zu stellen, auch wenn es soziale Verluste geben wird. Denn es sichert in seiner sozialevolutionären Logik die dauerhafte Anpassung an sich fortwährend verändernde, unkalkulierbare Um-Weltbedingungen. In der Tat vermischen sich im herrschenden Diskurs zur Corona-Pandemie die Bedrohung durch (z. B. pandemische oder auch klimabedingte) „Naturgefahren“ mit der (naturalisierten) ökonomischen Gefahr nachlassenden Wachtsums und nachlassender Konkurrenzfähigkeit von z.B. Unternehmen. Beides wird zur äußerlich-bedrohlichen „Natur“, der wir prinzipiell nicht entkommen, in der wir uns nur mit möglichst starker „Resilienz“ behaupten müssen. Entsprechend geht es in den Corona-Diskursen sowohl um die Aufforderung zur Stärkung der persönlichen physischen und psychologischen Fitness, um individuelle Techniken zur Bewältigung des erhöhten Stresslevels bei z.B. Kinderbetreuung im Homeoffice, Verlust von Angehörigen, Arbeitslosigkeit, Zukunftssorgen usw. wie auch um Forderungen nach Stärkung „der Wirtschaft“ zur Bewältigung nicht nur aktueller, sondern vor allem auch künftiger ökonomischer Krisen- und Bedrohungsszenarien (z. B. durch Steuersenkungen und weitere staatliche Zuwendungen für Unternehmen, Ausbau der Digitalisierung). „Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken“ lautet der Titel des wirtschaftswissenschaftlichen Sachverständigengutachtens für die Bundesrepublik Deutschland 2020/21. Welche Art von Krise uns dann jeweils erwartet, ist für dieses Verständnis grundsätzlicher ökonomischer, sozialer, ökologischer usw. Krisenhaftigkeit – die aber als solche nicht abänderbar ist – nachrangig. Ein insgesamt als unkalkulierbar konstruiertes ökonomisches wie außerökonomisches Außen wird zur dauerhaften und generalisierten Existenzbedingung; die externen Schocks stellen darin dann jeweils nur einen zwischenzeitlichen Höhepunkt dar.
These 3 Corona in der Perspektive gesellschaftlicher Naturverhältnisse
Gegen diese Engführungen und Verstellungen ist das Konzept bzw. das Debattenfeld der gesellschaftlichen Naturverhältnisse zentral. Diese Perspektive insistiert auf die strukturelle Rücksichtslosigkeit kapitalistischer Ökonomie, die in einem Modell von Ökonomie als (geschlossenem) Marktkreislauf gerade nicht zu fassen ist. Vielmehr muss die Pandemie als weiterer Höhepunkt einer tiefen Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse verstanden werden, eines fundamental gestörten sozialökologischen Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, wie es in Anlehnung an eine ursprünglich von Karl Marx stammende Formulierung heißt. Corona ist also gerade nicht als „externer Schock“ anzusehen, sondern sie muss als gesellschaftlich hervorgebracht analysiert werden.
Zwei Schwerpunkte haben sich bislang in der Diskussion zu Corona herausgebildet: Dies sind erstens die Analysen kritischer Epidemolog*innen. „Kapitalistische Ökonomie produziert Epidemien“ schreibt Rob Wallace und meint damit auf die strukturell rücksichtslose Profitorientierung, die alles Sozialökologische zum vernutzbaren Material degradiert. Vor allem das transnationale Agrobusiness steht im Fokus. Seine (großindustrielle) Plantagenwirtschaft zerstört die Artenvielfalt und damit den wichtigen natürlichen Schutz gegen die Ausbreitung von Viren und damit auch gegen Zoonosen (den Übergang vom Tier auf den Menschen). Über das weitere Vordringen in die Urwälder werden nicht nur Spezien weiter dezimiert, sondern vormalige „natürliche“ Grenzen zwischen Mensch und Tier überschritten und zerstört. Die Rechnung sei ganz einfach, so Wallace, je mehr abgeholzte Wälder, desto größer die Gefahr der Zoonose. Die Massentierhaltung mit ihren zusammengepferchten, oft geschwächten, gestressten und misshandelten Tieren ist demgegenüber ein idealer Virenverbreitungs- und Mutationsherd, ein booster, ein Brandbeschleuniger, wie die seit Jahrzehnten immer wiederkehrenden Pandemien wie Schweinegrippe, Vogelgrippe, das Dengue-Fieber und viele weitere zeigen. Auch in der chinesischen Region Wuhan wurde in den letzten Jahren eine agrar-industrielle Massenproduktion, vor allem der Fleischerzeugung, aufgebaut. Mit transnationalem Kapital errichtete chinesische Konglomerate gehören mittlerweile zu den wichtigsten Global Playern des Agro-Business. Zudem hat sich das Geschäft mit „exotic food“ als profitabler Geschäftsbereich dieser Konglomerate entwickelt. Dabei beteiligen sich offenbar vor allem jene ehemaligen Bauern und Landarbeiter der Region an der Beschaffung von („exotischen“) Wildtieren, die entweder von ihrem Land verdrängt wurden oder die ökonomisch mit der traditionell-kleinteiligen agraischen Ausrichtung nicht mehr überleben können. Ähnliche Prozesse spielen sich in vielen Regionen des „Globalen Südens“ ab, und auch das Corona-Virus entstand alles andere als überraschend, ist vielmehr eine Katastrophe mit Ansage. Warnungen gab es etliche: Das deutsche Robert Koch Institut im Jahr 2012 ein auf eine Virus-Mutation von SARS abzielendes Pandemie-Szenario; im gleichen Jahr schuf die Weltgesundheitsorganisation die corona-orientierte Kategorie „Pandemie X“ und entwickelte entsprechende Gefahrenszenarios und schon davor, im Jahr 2004, erklärte der ehemalige Leiter des Global-Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation, Klaus Stöhr, „Nach der Pandemie wird das schwierigste sein, der Öffentlichkeit zu erklären, warum wir nicht gehandelt haben, obwohl es genügend Warnungen gegeben hatte.“
Die zweite, besonders wichtige Diskussion von Corona in der Perspektive gesellschaftlicher Naturverhältnisse fokussiert auf die Natur des Menschen selbst. Im Zentrum steht hier seine Leiblichkeit, Verletzlichkeit und Bedürftigkeit, aber auch seine tätig-schaffende Auseinandersetzung mit der Natur in Form von Arbeit im allgemeinsten Sinne. Zu Beginn der Pandemie ging es diesbezüglich viel um die die (wesentlich „weiblichen“) Versorge- und Pflegearbeiten und es wurde die enorme Kluft weithin sichtbar zwischen den nun allgemein als „systemrelevant“ wahrgenommenen Sorgetätigkeiten einerseits und ihrem unverändert kaum anerkannten gesellschaftlichen Stellenwert andererseits. Dieser eklatante Widerspruch geht aber über die Frage der Bezahlung und der Arbeitsbedingungen von spezifischen Beschäftigtengruppen weit hinaus. Vielmehr sind der Pflegebereich ebenso wie das Agrobusiness nur die Spitze des Eisbergs. An ihnen wird besonders eindrücklich sichtbar, wie überfällig und dringend ein grundsätzlich verändertes Verständnis von Arbeit und Ökonomie ist. Statt die sozialökologische Zerstörung fortzusetzen, und ihre Konsequenzen als externe Naturgefahren und Abfolge vermeintlich überraschender Schocks aufzufassen (gegen die „Wir“ uns wappnen müssten) braucht es eine Überwindung der gegenwärtigen „class-racial-gender order“, wie Stefania Barca es nennt.
Um diesen Paradigmenwechsel zu stärken, ist die feministische Care-Debatte zentral. Care, das wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert, ist nicht nur als bereichsbezogene Arbeitstätigkeit in Haushalt- und Pflegeberufen aufzufassen. Fürsorgliche Praxis ist vielmehr als Schlüsseldimension jeglichen sozialintegrativen gesellschaftlichen Zusammenlebens und -arbeitens überhaupt zu verstehen – eine unhintergehbare Dimension jeglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens und -arbeitens. Care in diesem weiten Sinne meint ein anteilnehmend-sorgendes Weltverhältnis zu Mensch und Natur das allerdings selbst (wie wir in der Corona-Pandemie gut beobachten konnten) sexistisch, verwertungslogisch und auch rassistisch (denken wir an die osteuropäischen Landarbeiter*innen) unterdrückt und abgespalten wird. Dabei kommt auch die kapitalistische Ökonomie und Organisation gesellschaftlicher Arbeit selbst nicht ohne zugewandte Sozialität, Kollegialität und Fürsorge aus – eben das zeigt die Diskussion zu „systemrelevanter“ Pflege. Statt also in einem fort für mehr ökologische Achtsamkeit zu plädieren oder Pflegekräfte und Verkäuferinnen als „Helden“ zu beklatschen, braucht es eine fundamentale strukturelle Umgestaltung unserer gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Das schließt einen Umbau des herrschenden Verständnisses von „Ökonomie“ und der Organisation „gesellschaftlich-relevanter“ Arbeit ein. Gesellschaft und (arbeitende) gesellschaftliche Praxis ist von den Erfordernissen des Sorgens und der sozialökologischen Reproduktion her praktisch neu zu strukturieren, und zwar so, dass dem Menschen als leiblich-verletzlichen, aber auch sozial-kreativem Naturwesen in seiner Vielfalt und quer über den Globus Rechnung getragen wird.
Weitere Beiträge aus dem Workshop:
0. Intro
1. Warum Corona kein externer Schock ist und warum es keine Rückkehr zur Normalität geben darf (Stefanie Hürtgen)
2. Warum die herrschenden gesellschaftlichen Naturverhältnisse und Sorgeverhältnisse auf der kapitalistischen (neoliberalen?) Form gesellschaftlicher Arbeit beruhen (Christa Wichterich)
3. Warum der Zusammenhang zwischen der äußeren und der inneren Natur des Menschen die Demokratisierung der Demokratie notwendig macht (Ingrid Kurz-Scherf)
4. Warum sich ein reproduktionsorientierter Ansatz statt am Geld an der Zeit orientieren sollte (Fritz Reheis)
Download als PDF