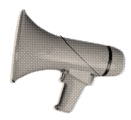Vom Kolonialrevisionismus zu Amnesie und Verweigerung – Deutscher Umgang mit der Kolonialvergangenheit am Beispiel Namibias
Kolonialrevisionismus
Mit dem Versailler Vertrag wurde Deutschland zum „ersten postkolonialen Land in einer noch immer kolonialen Welt“ (Marcia Klotz). Auch nach dem Ende deutscher Kolonialherrschaft blieb Deutschland durch diese Erfahrung geprägt – zum einen, weil der mit der kolonialen Expansion verknüpfte Traum der „Weltpolitik“ keineswegs ad acta gelegt wurde, zum andern, weil recht kleinteilig und hartnäckig daran gearbeitet wurde, in den ehemaligen deutschen Kolonien einen „Fuß in der Tür“ zu behalten. Zunächst nahm dies offenkundige Formen in Form des Kolonialrevisionismus rechter Parteien und Vereinigungen an, die für die Rückgewinnung „unserer schönen Kolonien“ trommelten, mit Unterstützung der Reichsregierung Siedlungsprojekte vor allem in Namibia verfolgten oder den Verkauf „deutscher Bananen“ aus Kamerun organisierten. All dies stand vor dem Hintergrund, dass der Entzug der Kolonien zugleich als Ausstoßung aus dem Kreis der „zivilisierten“ Staaten verstanden wurde. Aus dieser Sicht gehörte Kolonialherrschaft zum „zivilisierten“ Status dazu. Auch dies kann vielleicht erklären, dass sich 1919 eine breite Front einschließlich der SPD vehement gegen den „Verlust“ der Kolonien wandte. Nur USPD und KPD positionierten sich antikolonialistisch. Die Stärke des Kolonialrevisionismus kommt auch darin zum Ausdruck, dass etwa Konrad Adenauer 1931-33 als Geschäftsführender Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft amtierte.
Die Nazis schalteten auch diesen Bereich unter Führung von Franz Ritter von Epp, eines Veteranen der Völkermord-Kampagne in Namibia, gleich. Die von ihnen propagierten Pläne für ein Kolonialreich „Mittelafrika“ standen jedoch immer zurück gegenüber der im Zweiten Weltkrieg betriebenen Kolonisation des europäischen Ostens, die vielen Millionen Menschenleben kostete. Nach Stalingrad waren alle solche Träume Makulatur, jedoch blieb der deutsche Völkermord in Namibia präsent, etwa in Form von Feldausgaben des erstmals 1906 erschienenen, weit verbreiteten Romans Peter Moors Fahrt nach Südwest von Gustav Frenssen, der eine pseudotheologische Rechtfertigung des Landraubs enthält.
Koloniale Amnesie
Mit der Niederlage von Nazi-Deutschland hatte der Kolonialrevisionismus ausgespielt. Die deutsche Kolonialvergangenheit trat – sicherlich auch angesichts des Kampfes um eine auch nur ansatzweise ehrliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen – in den Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins. Dazu dürfte auch der Umstand beigetragen haben, dass Deutsche sich hier einmal entlastet fühlen konnten, weil die teils blutigen Entkolonialisierungskonflikte wenigstens dem Anschein nach andere betrafen und man glauben mochte, sich auf die Rolle der Zuschauenden beschränken zu können.
Daran änderten auch die Aktivitäten von Traditionsvereinen der Schutztruppen, oder etwa Reden von Kolonialnostalgikern wie des langjährigen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Bundesverteidigungsministers und Bundestagspräsidenten Kai-Uwe von Hassel und auch des ebenfalls langjährigen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier (beide CDU) ebenso wenig wie gelegentliche Vorstöße, die auf die dunklen Aspekte der deutschen Kolonialvergangenheit hinwiesen wie der Fernsehfilm Heia Safari von Ralph Giordano, der 1966 heftigen Widerspruch von apologetischer Seite auslöste. Auch die seriöse Forschung, die zunächst eher in der DDR ab Mitte der 1960er Jahre auch in der BRD in Gang kam, änderte an diesem Gesamtbild nichts. Die koloniale Amnesie, die sich aus dieser Periode herleitet, bedeutet nämlich nicht, dass etwas nicht bekannt ist, sondern dass diese Inhalte nicht thematisiert und bestenfalls an den Rand gedrängt werden, also politisch keine Rolle spielen. Das zeigt sich bis heute an der (Nicht-)Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia, insbesondere mit dem Völkermord 1904-08, wobei die Erinnerung an die Verhältnisse in den anderen ehemaligen deutschen Kolonien eher noch stärker an den Rand gedrängt ist.
Die „besondere Verantwortung“ für Namibia
Speziell im Hinblick auf Namibia liefen die Verbindungen mit Verwandten oder Gleichgesinnten unter den „Südwestern“ weiter; die unter den deutschsprachigen Namibier:innen verbreitete Nazi-Nostalgie spielte dabei zweifellos eine Rolle. Zugleich setzten sich Wanderungsprozesse zwischen beiden Ländern fort – nicht allein, als nach 1945 NS-Belastete auch im Südlichen Afrika, zumal unter den Fittichen der seit 1948 in Südafrika herrschenden Nationalpartei Zuflucht suchten. Andere kamen wie schon in den Jahrzehnten zuvor aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Abenteuerlust. Die Bundesregierung unterhielt bis 1977 viele Jahre ein Konsulat in Windhoek, auch als die südafrikanische Herrschaft in Namibia völkerrechtlich bereits für illegal erklärt war. Auch deutsche Privatschulen wurden unterstützt. Kritik daran richtete sich aber vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Apartheidregime. Der Bezug auf die deutsche Kolonialvergangenheit trat auch hier in den Hintergrund.
Unmittelbar vor Beginn des nach jahrzehntelangem Befreiungskrieg und zähen Verhandlungen vereinbarten Unabhängigkeitsprozesses für Namibia am 1. April 1989 beschloss der Bundestag eine Resolution, in der die „besondere Verantwortung“ Deutschlands für Namibia festgehalten wurde, ohne dafür aber eine Begründung zu geben. Union, FDP, SPD und Grüne hatten sich nicht einigen können, ob diese Verantwortung auf der kolonialen Vergangenheit, der Anwesenheit der Deutschsprachigen oder der Zusammenarbeit von Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur mit dem Apartheidregime beruhe, oder doch auf der intensiven Mitarbeit der BRD in der UN-Kontaktgruppe, die das Abkommen vorbereitet hatte. Der Völkermord wurde in keinem der Entwürfe als solcher benannt, einzig Günter Verheugen (SPD) nahm das Wort in der Debatte in den Mund – das letzte Mal auf lange Zeit, dass dies im Bundestag geschah.
Die Realität der Verdrängung
Als Bundeskanzler Kohl (CDU) 1995 das unabhängige Namibia besuchte, ließ er den Empfang durch Präsident Nujoma eigens verschieben, um seine „lieben Landsleute“ – eine Versammlung von „Südwestern“ – zu begrüßen. Für eine Delegation von Ovaherero hatte er schon gar keine Zeit. Zwei Jahre später empfing Bundespräsident Herzog zwar eine solche Delegation, ließ sie aber mit fadenscheinigen juristischen Belehrungen über die Sinnlosigkeit ihrer Reparationsforderungen abblitzen. Außenminister Joseph Fischer (GRÜNE) bekräftigte dann 2003 bei einem Zwischenstopp in Windhoek, dass es aus Sicht der Bundesregierung eine „entschädigungsrelevante Entschuldigung nicht geben“ werde.
Das Erinnerungsjahr 2004, hundert Jahre nach dem Beginn des Völkermords, markiert einen Einschnitt. Zunächst wurde eine Bundestagsresolution zu diesem Jahrestag auf Druck des Auswärtigen Amtes (AA) in einer Weise umgeschrieben, dass sie von Opfergruppen in Namibia als Beleidigung verstanden wurde. Wenige Wochen später hielt die damalige Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), auf der zentralen Gedenkveranstaltung auf dem Schlachtfeld von Ohamakari (Waterberg) eine Rede, die zunächst als möglicher Wendepunkt erschien. Die Ministerin benannte den Völkermord und bat „in den Worten des Vaterunser“ um „Vergebung für unsere Verfehlungen“. Freilich zeigte sich, dass dies keineswegs eine regierungsamtliche Verlautbarung war; zudem war die Erwähnung des Völkermordes mit der juristischen Kautele versehen, das Vorgehen der Schutztruppe sei nur „aus heutiger Sicht“ so zu bewerten, dies könne aber keinen Anspruch auf Entschädigung bzw. Reparation nach sich ziehen. Bis in die Gegenwart hält die amtliche deutsche Politik an dieser auf die Intertemporalität des Völkerrechts bezogenen Position fest, nach der sich die Schutztruppe nach damaligem Recht nichts habe zuschulden kommen lassen – eine letztlich kolonialistische Auslegung, da sie den Kolonisierten den Status legitimer Belligerenten, also das Recht als Kriegführende nach den Regeln bestehender internationaler Konventionen anerkannt zu werden, verweigert. Damit wird die Gültigkeit, der auch damals schon bestehenden Rechtsvorschriften im Fall von Kolonialkriegen abgestritten, wie dies seinerzeit schon General Lothar von Trotha getan hat. Nach Wieczorek-Zeuls Rede flackerten in Namibia Hoffnungen auf, die jedoch bald enttäuscht wurden. Eine halbherzige Versöhnungsinitiative verlief im Sande. 2004 leitete aber eine Entwicklung ein, in der sich unterschiedliche Opfergruppen zusehends vernetzten und verbündeten. Ein Meilenstein war 2006 die einstimmige Verabschiedung einer Resolution der Nationalversammlung, in der die namibische Regierung beauftragt wurde, Verhandlungen zwischen den Opfergruppen und der Bundesregierung zu ermöglichen.
In Deutschland erregte der hundertste Jahrestag des Völkermords eine überraschend große Aufmerksamkeit, vor allem in Form von Veranstaltungen, aber auch Ausstellungen. Ähnliches galt 2005 für den hundertsten Jahrestag des Maji-Maji-Krieges im heutigen Tanzania. Auch wenn das breite Interesse bald abebbte, so war dies doch der Ausgangspunkt für die verstärkte Bildung postkolonialer Initiativen. Ab 2005 fand insbesondere die Kampagne für die Anerkennung des Völkermords in Namibia, Entschuldigung und Entschädigung mit der LINKEN auch ein Sprachrohr in im Bundestag.
Eine neue Dimension bedeutete 2011 die erste Rückführung deportierter menschlicher Überreste aus der Charité in Berlin nach Namibia. Erneut war dies ein Anlass für großes Medieninteresse; zugleich zeigten sich die extremen Unterschiede in der (öffentlichen) Wahrnehmung. Aus Namibia reiste eine mehr als 70köpfige Delegation unter Leitung des Kultur-Ministers an, die von der Bundesregierung unter Verweis auf den Kulturföderalismus fast vollständig ignoriert wurde, mit Ausnahme des Auftritts der Staatsministerin im AA Pieper bei der eigentlichen Übergabezeremonie, die nach ihrer von Protesten begleiteten Rede abrupt den Saal verließ. Für die namibischen Delegierten ging es um die Rückkehr ihrer Ahnen, auch wenn deren Schädel bis heute nicht eindeutig identifiziert werden können. Das Verhalten der Bundesregierung war demgegenüber ignorant und verletzend. Auch zwei weitere Rückgaben menschlicher Überreste 2014 und 2018 waren von Konflikten überschattet, die sich allerdings verlagert hatten: Offenbar ging es beiden Regierungen 2014 darum, alles geräuschlos zu inszenieren, was zum faktischen Ausschluss der Opfer- und damit auch Herkunftsgruppen führte. Der Riss zwischen Regierung und einem Großteil der Opfergruppen, der die weitere Entwicklung wesentlich prägen sollte, deutete sich hier bereits an.
Der Verhandlungsprozess ab 2015
Diese Konfliktkonstellation kam vollständig zum Ausdruck mit dem Verhandlungsprozess zwischen beiden Regierungen ab 2015. Im Juli dieses Jahres ließ das AA auf offenkundig gezielt informelle Weise wissen, dass es von der jahrzehntelang mit eiserner Konsequenz festgehaltenen Tabuisierung des Wortes „Völkermord“ für die 1904-08 in Namibia begangenen Verbrechen abrücke. Jedoch wurde gleich nachgeschoben, es handele sich dabei lediglich um eine „moralische und historische“ Bewertung, die keine juristische Folgen nach sich ziehe, also vor allem keinen rechtlichen Anspruch auf Reparation. Die von Außenminister Fischer 12 Jahre zuvor ausgegebene Parole blieb demnach gültig. Dies erwies sich auch als zentrale Leitlinie des AA in dem Ende 2015 eingeleiteten Verhandlungsprozess. Dieser war auf namibischer Seite von vorneherein durch einen Dauerkonflikt zwischen der Regierung und den Opfergruppen geprägt, deren Mehrheit entsprechend der Resolution der Nationalversammlung von 2006 eine eigenständige Rolle am Verhandlungstisch forderte, während die Regierung auf ihre Souveränitätsrechte als Vertretung des gesamten Volkes von Namibia pochte. Für die Vertretungen der Opfergruppen, die sich darauf einließen, blieb die Beteiligung an einem „Technical Committee“. Insbesondere die Ovaherero Traditional Authority, eng verbunden mit der Ovaherero Genocide Foundation sowie die mit diesen verbündete Nama Traditional Leaders Association entfalteten unter der zentralen Parole „Anything Without Us Is Against Us“ eine umfassende Kampagne mit den zentralen Forderungen der Anerkennung des Völkermords, einer Entschuldigung durch Deutschland und angemessenen Reparationen bzw. Wiedergutmachung sowie einer angemessenen Beteiligung am Verhandlungsprozess. Diese Forderungen waren auch Gegenstand eines 2017 angestrengten Verfahrens vor einem Gericht in New York, das aber ähnlich wie ein ähnlicher, 2001 unternommener juristischer Vorstoß nicht zur Verhandlung kam, weil das Gericht sich für nicht zuständig erklärte.
Das Abkommen „Joint Declaration“ (JD), das im Mai 2021 paraphiert und veröffentlicht wurde, enthält eine ausgehandelte Entschuldigungsformel und die Zusage von 1,1 Milliarden Euro „Zuschuss“ (grant) über 30 Jahre. Da auch die namibische Regierung immer auf Reparationen bestanden hatte, war klar, dass sich die deutsche Seite klar durchgesetzt hatte. Es war absehbar, für das AA aber wohl überraschend, dass in Namibia ein Sturm der Entrüstung losbrach. Schließlich ließ sich das AA darauf ein, Modalitäten nachzuverhandeln. Doch bleibt es Mitte 2025 den sowohl in Namibia als auch in Deutschland neu ins Amt gekommenen Regierungen überlassen, was mit der JD am Ende geschieht.
Die Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements
Die hier nur sehr kursorisch dargestellten Vorgänge um die JD unterstreichen zum einen die geringe Priorität, die eine Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit in der formellen deutschen Politik, aber auch in breiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit genießt. So steht auch das bereits in mehreren Koalitionsverträgen im Bund und in Berlin avisierte zentrale Denkmal zur Erinnerung an die deutschen Kolonialverbrechen noch immer in den Sternen. Die Restitution geraubter Kunstgegenstände wie auch der unbestimmten Anzahl noch immer in deutschen Sammlungen vorhandener menschlicher Überreste geht eher schleppend voran. Das steht in deutlichem Gegensatz zur Lage in Namibia, wo die Regierung gewiss Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland gegenüber Fragen der Kolonialvergangenheit priorisiert, sich aber einer sehr viel stärker artikulierten Öffentlichkeit konfrontiert sieht, zu der neuerdings auch junge Aktivist:innen, oft ohne direkte Beziehung zu den Opfergruppen zählen.
Es zeigt sich, dass koloniale Amnesie im Sinne der Nicht-Thematisierung der Kolonialvergangenheit in Deutschland weiter vorherrschend ist. Dabei sollen kleinere Fortschritte zivilgesellschaftlicher Gruppen nicht übersehen werden, die teils langfristig und mit großem Engagement Informations- und Aufklärungsarbeit leisten. Das gilt insbesondere für lokale postkoloniale Initiativen in zahlreichen Städten, die etwa durch postkoloniale Stadtrundgänge und entsprechende Internetangebote, aber auch durch Initiativen zur Umwidmung von Denkmälern oder zur Umbenennung von Straßen eine Sensibilität für fortbestehende koloniale Bezüge auch im alltäglichen Umfeld fördern. Entsprechende Gruppen unterhalten auch regelmäßige Kontakte zu Opfergruppen in Namibia. Dennoch bleibt auf absehbare Zeit eine starke Diskrepanz zwischen der Herausforderung eines angemessenen Umgangs mit der deutschen Kolonialvergangenheit und der Realität. Umso mehr ist das Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen unterschiedlichster Art die einzige Chance, langfristig eine Änderung zu bewirken.
Teil I dieses Beitrages “Deutsche Kolonialherrschaft in Namibia”
Attac organisiert im Oktober 2025 eine Rundreise von namibischen Aktivist:innen durch 10 deutsche Städte, bei der ihre Forderungen im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialgeschichte einerseits und der neokoloniale Charakter geplanter 'grüner Wasserstoffprojekte' andererseits thematisiert werden.
Download als PDF