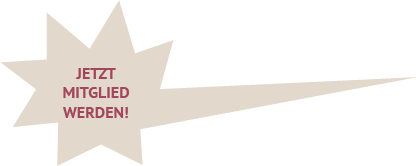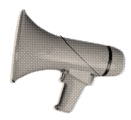Alexis Passadakis: Energiedemokratie jetzt!
Im Jahr 1946 war es endlich soweit: Die teure und unzuverlässige Stromversorgung der kalifornischen Hauptstadt Sacramento wurde nach einem Volksbegehren von einem privaten Unternehmen in die Öffentliche Hand übertragen. Die von den BürgerInnen damals durchgesetzte Form des neuen öffentlichen Unternehmens unterscheidet sich erheblich von dem "Stadtwerk" wie es in der Bundesrepublik üblich ist. Denn wenn in der Westküstenstadt Kommunalwahlen stattfinden, wählen die EinwohnerInnen zusätzlich den siebenköpfigen Verwaltungsrat des lokalen Stromversorgers SMUD. Jeder Bezirk entsendet eine Person, die sich im Wahlkampf den energiepolitischen Vorstellungen der Bevölkerung stellen muss.
Angesichts dieser demokratischen Kontrolle, ist es kein Zufall, dass SMUD bei nationalen Umfragen zur Kundenzufriedenheit immer Spitzenwerte erreicht, dass es ein Sozialtarifsystem gibt und im Vergleich zu den anderen Stromversorgern in den USA einen der höchsten Anteile an Erneuerbaren Energien im Strommix hat. Im übrigen spricht das demokratische Stadtwerk in Sacramento der Strombezieher nicht als "Kunden" an, sondern als "customer-owners", also Kunden-Eigentümer. Bei strategischen Weichenstellungen gibt es außerdem die Möglichkeit eines Volksentscheides.
Beispielsweise stand im Jahr 1989 die Frage "Atomkraft? Ja oder Nein" zur Abstimmung. Die Mehrheit stimmte dagegen und wenige Tage später wurde das SMUD-Atomkraftwerk Rancho Seco vom Netz genommen. Derart durchschlagskräftig kann lokale Energiedemokratie sein, um ökologischer und sozialer Ziele zu erreichen. In der Bundesrepublik existiert ein solches Modell bisher noch nicht. Stattdessen ist der Energiesektor stark konzentriert und von Stadtwerken mit obrigkeitsstaatlicher Struktur geprägt.
In der Bundesrepublik sind über 80 Prozent der Stromproduktion in der Hand der Konzerne E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall, die über zahlreiche Beteiligungen auch bei der Versorgung ein Oligopol bilden. Sie alle sind bzw. waren – im Fall von EnBW – transnationale Konzerne, deren Daseinsberechtigung darin besteht ihren Aktionären möglichst hohe Renditen zu verschaffen.
Die Macht der Großen Vier
Ihre wirtschaftliche Macht übersetzen sie in politische Macht. Mittels der Liberalisierung des Strommarktes durch die Regierungen und die Europäische Union seit den 90er Jahren und der Privatisierungswelle bei lokalen und regionalen Versorgern wurden gezielt Unternehmen geschaffen, die als "Global Player" oder zumindest als "Euro-Champions" agieren können.
Der GAU in Fukushima, die kräftigen Proteste der Anti-Atombewegung und auch der Anti-Kohlekraftwerksbewegung haben die Durchsetzungskraft der Großen Vier eingeschränkt, was sie allerdings nicht daran hindert die "Energiewende" der Bundesregierung auf Off-Shore-Windparks, Desertec und transnationalen Stromhandel via Strom-Autobahnen auszurichten. Die Spielräume für die regionale und lokale Ebene sollen möglichst gering bleiben. Demokratische Kontrolle Fehlanzeige.
Ohne den Zugriff der BürgerInnen auf Energieunternehmen werden daher auch vermeintliche Erfolge von sozialökologischen Bewegungen rasch Grenzen aufgezeigt: Nachdem in Berlin ein breites Bündnis von Initiativen daran mitwirkte ein neues Kohlekraftwerk des schwedischen Staatskonzerns Vattenfall in Klingenberg/Berlin zu verhindern, kündigte das transnationale Unternehmen den Bau eines Biomassekraftwerks an. Für warme Berliner Stuben soll nun dort Holz aus Übersee verfeuert werden, u.a. aus Liberia. Eine ökologische Energiewende hin zu Erneuerbaren hatten sich die meisten AktivistInnen anders vorgestellt.
Neben den Energieriesen spielen in Deutschland Stadtwerke, Stadtwerksverbünde und regionale Versorger weiterhin eine wichtige Rolle. Auch wenn sie zu 100 Prozent in öffentlichem Besitz sind, ist in vielen Fällen ihre Unternehmensführung alles andere als transparent und die Dienstleistungen nicht besonders sozial. Im Stromsektor lässt auch oft das Engagement für Erneuerbare Energien zu wünschen übrig. Seilschaften aus Parteien und Verwaltung betrachten öffentliche Unternehmen mitunter als Beute – nicht selten im Verein mit lokalen Unternehmergrößen.
Stadtwerke in der Obrigkeitsfalle
Das Verhältnis von öffentlichen Unternehmen zu "ihren" KundInnen steht häufig in der Traditionslinie obrigkeitsstaatlicher Verwaltungsmuster. Einblicke in das Unternehmen sind kaum zu bekommen – oft auch für Stadtverordnete nicht, geschweige denn für die "NormalbürgerInnen". Und wer seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, wird abgeklemmt. Ein Bewusstsein für ein soziales Recht auf Energie besteht kaum. Hinzu kommt seit den 90er Jahren eine Überlagerung dieser "traditionellen" Struktur durch die Ökonomisierung, so dass viele öffentliche Unternehmen sich inzwischen als gewinnnorientierte Akteure am Markt begreifen.
Angesichts der obrigkeitsstaatlichen Struktur der Stadtwerke stieß die Privatisierungs- und Konzentrationsdynamik in den 90er Jahren auf wenig Widerstände, weil viele BürgerInnen die öffentlichen Unternehmen nicht als ihr Eigentum ansahen. Die neoliberale Staatskritik, die öffentliche Unternehmen grundsätzlich als "ineffizient" verunglimpft, hatte hier einen realen Ansatzpunkt. Das Beispiel Sacramento zeigt, dass es eine Energieversorgung jenseits von Konzernen und "konventionellen" Stadtwerken gibt: Nämlich öffentliches Eigentum, das mittels Verfahren repräsentativer Demokratie und an entscheidender Stelle zusätzlich mittels direkter Demokratie kontrolliert wird.
Die seit ein paar Jahren zumindest auf einigen Feldern festzustellende Ermattung der neoliberalen Privatisierungsideologie bietet die Chance Rekommunalisierungen durchzusetzen und die Rolle öffentlicher Wirtschaft neu zu diskutieren. Auch wenn deutsche Kommunalverfassungen derartige Modelle bisher nicht vorsehen, ist es letztendlich eine Frage der Stärke sozial-ökologischer Bewegungen neue Verfahren der Partizipation zu entwickeln und zu etablieren.
Zu berücksichtigen ist im deutschen Kontext in jedem Fall das wichtige Element der betrieblichen Mitbestimmung. In einem Stadtstaat wie Berlin wäre es beispielsweise denkbar mit einer Änderung des "Berliner Betriebegesetzes" einen Aufsichtsrat mit VertreterInnen des Landes, der Beschäftigten und direkt gewählten RepräsentantInnen zu besetzen. Ein anderes Modell könnte darin bestehen, eine öffentliche Eigentumsform mit einer Genossenschaft zu kombinieren und so eine neue Form demokratischer Kontrolle zu garantieren. Eine dritte Form wäre die Übertragung der Idee des Bürgerhaushalts auf öffentliche Unternehmen, wie es in der "Geburtsstadt" des Bürgerhaushalts in Porto Alegre (Brasilien) tatsächlich auch praktiziert wird. Spezifisch auf einen kommunalen Energieversorger zugeschnittene Verfahren der BürgerInnenbefragung plus BürgerInnenversammlungen würde über strategische Investitionsentscheidungen entscheiden.
Die Krise des Energiesystems und den Wunsch nach mehr Demokratie nutzen
Das Auslaufen von Hunderten von Konzessionsverträgen für die lokalen Netze in den nächsten Jahren bieten die Chance Rekommunalisierungen und Gründungen von Stadtwerken anzuschieben und Energiedemokratie auf die Agenda zu setzen. Es ist offensichtlich, dass das Weltenergiesystem sich im Umbruch befindet: Die Klimakrise, die Knappheit von Energierohstoffen und die Atomkatastrophe in Japan bewirken eine Veränderungsdynamik, die neue Spielräume für eine ökologische, soziale und demokratische Energieversorgung bietet.
Zudem zeigen sowohl die Proteste gegen Stuttgart 21 als auch die Protestbewegungen der "Empörten" unter dem Namen "Democracia Real Ya!" (Wirkliche Demokratie Jetzt!) in Spanien und Griechenland gegen Sozialabbau, dass es ein neues starkes Verlangen nach einer Vertiefung von Demokratie gibt. Das letzte Wort der Geschichte über die gegenwärtige Form von Demokratie scheint noch nicht gesprochen zu sein. Der politisch so heiß umkämpfte Energiesektor bietet sich als Erprobungsfeld neuer demokratischer Modelle an.
Alexis J. Passadakis ist Miglied im Koordinierungskreis von Attac. Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift "Robin Wood", Nr. 3/11.