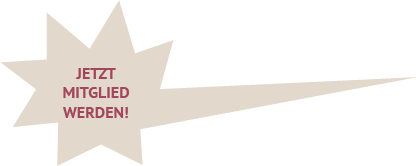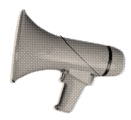Ein Jahr nach Genua: Breite Akzeptanz für globalisierungskritische Bewegung
Während vor einem Jahr Globalisierungskritik kaum ernst genommen wurde, ist sie mittlerweile bis zum Bundespräsidenten vorgedrungen. Globalisierung wurde von dem Mythos, sie sei ein unumkehrbarer Prozess zum Wohle aller Menschen, befreit. Die Globalisierungskritiker konnten die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass wenigen Gewinnern sehr viele Verlierer gegenüberstehen. „Mit Attac kämpfen Organisationen und Einzelpersonen für eine der Ökologie und dem Menschen verpflichtete Form der globalen Vernetzung und weltweiten Austauschs. Mit Kreativität und ökonomischer Bildung greifen wir Ungerechtigkeit und Armut global und lokal an“ meint Attac-Pressesprecherin Eleonore Wiedenroth. Seit Genua ist die Anzahl der Mitglieder von damals 400 auf inzwischen 7.690 angestiegen, mehr als 120 Ortsgruppen in West und Ost haben sich gegründet, und täglich gibt es weitere Anfragen wegen Unterstützung bei Neugründungen. Die Strukturen wurden dem Wachstum angepasst, um die politischen Entscheidungen effektiv umzusetzen. Außerdem wurde im Frühjahr ein wissenschaftlicher Beirat ins Leben gerufen, der die Expertise verstärkt. Zum ersten Mal öffnet Attac im Juli die Pforten zu einer großen bundesweiten Sommerakademie. Auch an den bevorstehenden internationalen Protesten gegen die neoliberale Globalisierungspolitik auf dem Europäischen Sozialforum in Florenz (November) sowie anlässlich des EU-Gipfels in Kopenhagen (Dezember) werden sich die Globalisierungskritiker aus Deutschland wieder aktiv beteiligen.
Weil Politik nicht nur auf Gipfeln sondern tagtäglich stattfindet, ruft Attac unter dem Motto „Her mit dem schönen Leben. Eine andere Welt ist möglich“ gemeinsam mit fünf Jugendgewerkschaftsverbänden zu einer Großdemonstration am 14. September in Köln auf. Hier werden Tausende Menschen, Jung und Alt, für eine gerechte Umverteilung, Solidarität, Frieden und Demokratie demonstrieren auf. In diesem Jahr widmet sich Attac Deutschland unter anderem auch den innenpolitischen Erscheinungsformen neoliberaler Politik wie Flexibilisierung, Deregulierung und Privatisierung in bisher öffentlichen Bereichen wie dem Gesundheits- und Bildungssystem. „Den Menschen drohen Zweiklassenmedizin und Zweiklassenbildung. Krankheit wird wieder zum Armutsrisiko. Bildung wird wieder ein Gut, das nur mit Geld zu erreichen ist. Zwar bedienen sich PolitikerInnen immer öfter der Rhetorik von GlobalisierungskritikerInnen, ihre Handlungen hingegen sprechen noch immer eine ganz andere Sprache“ erläutert Frau Wiedenroth den ungebremsten Zulauf.