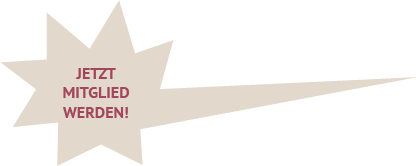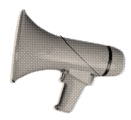Die soziale Ökologie des Kapitals
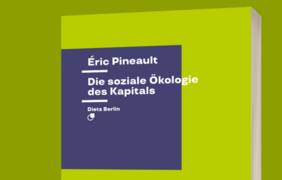
Éric Pineault
Die soziale Ökologie des Kapitals
Dietz Verlag Berlin 2025
190 Seiten, 25,00 Euro
ISBN: 978-3-320-02423-9
Dass „Gesellschaften aktiv, passiv und auf ungleiche Weise an biogeochemischen Kreisläufen und ökologischen Prozessen teil(nehmen)“ (S. 16), wie Éric Pinault in der Einleitung schreibt, verrät sehr viel über seine Herangehensweise. Er betrachtet Gesellschaft zwar sehr wohl als politisches, soziales Phänomen, aber im vorliegenden Buch interessiert ihn der biologische, geologische, chemische Austausch von Materialien und Energie, den Gesellschaften tätigen. So wie in einem Körper kann man diesen Vorgang als gesellschaftlichen „Stoffwechsel“ bezeichnen. Innerhalb der geophysikalischen Gesetze bedeutet dieser Stoffwechsel, dass die in Gesellschaften bewegten Materialien und Energie sich von niedriger zu höherer Entropie verändern. Innerhalb der menschlichen Wahrnehmung stellen sich diese Vorgänge als „soziale Beziehungen, symbolische Bedeutungsstrukturen, Institutionen, Ideologie und Macht“ dar. Der gesellschaftliche „Stoffwechsel ist eine 'soziale Ökologie', … er existiert als Vermittlung: Soziale Beziehungen vermitteln natürliche Prozess und natürliche Prozesse vermitteln soziale Beziehungen.“ (S.18f) Diese Dialektik ist das eine, das die Leserin während der Lektüre nicht aus dem Kopf verlieren darf.
Auch wenn Karl Marx den Begriff des Stoffwechsels als erster auf den Arbeitsprozess angewandt hat und auch „Risse“ im gesellschaftlichen Stoffwechsel konstatierte, war sein Projekt das der Kritik der politischen Ökonomie, nicht der sozialen Ökonomie. Deren Kritik muss „über Marx hinausgehen“ (S. 22). Aber sie wird nicht ohne ein Verständnis dessen auskommen, was Marx im kapitalistischen Arbeitsprozess vor allem sah und kritisierte, die Produktion des Mehrwerts. Das geschieht, indem die Arbeiterin während ihres Arbeitstages mehr Produkt herstellt, als sie für ihren Lebenserhalt brauchen würde. Ein Mehrprodukt ist der menschlichen Arbeit immer eigen gewesen, anders hätte keine Gesellschaft entstehen können mit Freizeit, Feier, Versorgung der Alten, Kunst, Religion, Institutionen aller Art. Im Kapitalismus gehört dieses Mehrprodukt dem Kapitalisten und der will das daraus gewonnene Geld in einen neuen Zyklus von Investition, Produktion und Verkauf stecken, aus dem wieder mehr Geld herauskommt. Das ist der zweite Zusammenhang, der während des ganzen Buches präsent ist: Im Kapitalismus wird nicht produziert, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um ein immer größeres Mehrprodukt zu schaffen. Im fünften Kapitel wird Pineaults seine Sicht darauf ausführlicher erklären.
Marx hatte diesen ganzen Vorgang aber nur am Rand von der stofflichen Seite her betrachtet, ihm war es nicht um die konkreten Produkte gegangen. So wie die Arbeiterin Dinge hergestellt hat, die sie gar nicht braucht, so ist auch der Kapitalist nicht an den konkreten nützlichen Eigenschaften der Produkte interessiert, sondern daran, dass sie einen „Wert“ haben, dass das Mehrprodukt einen Mehrwert darstellt und sich verkaufen lässt, also „Kapital“ ist. Aber das gesamte Produkt ist immer auch biogeochemisches Material und Energie und das ist es, das Pineault untersucht. Dabei ist die eigentümliche Form des Kapitalkreislaufs festzuhalten. Er startet mit Geld, das die Kapitalistin investiert, durchläuft den Produktionsprozess, in dem das Geld die Form von Rohstoffen, Maschinen, Arbeiterinnen annimmt, die es in Waren verwandeln. Sind die verkauft, liegt es wieder in der Ausgangsform vor, als Geld. „Diese Reversibilität der kapitalistischen Wertform steht in starkem Kontrast zur thermodynamischen Irreversibilität des zugrunde liegenden Prozesses eines materiellen Durchsatzes.“ (S. 37) Was einmal Entropie ist, wird nie wieder Rohstoff.
Obwohl von der Wertseite her der kapitalistische Produktionsprozesses also reversibel ist und von der materiell-stofflichen Seite her nicht, handelt es sich ja aber um ein und denselben Prozess, in dem aber eines das andere antreibt. Das Mehrprodukt soll, „will“ sozusagen, Mehrwert werden. Was nur gelingt, wenn es auch verkauft wird. Und der Mehrwert existiert nur, um erneut ein Mehrprodukt zu schaffen. Da ein größerer Wert beim Beginn des nächsten Zyklus auch ein noch größeres Mehrprodukt schafft, ergibt sich gleichzeitig eine immer weiter steigende Entropie und ein immer größerer Durchsatz an Energie und Material. Gleichzeitig wird das Verkaufsproblem ständig dringender. Sobald kein großer Mangel mehr da ist, müssen auch immer mehr „Bedürfnisse“ geschaffen werden, die die produzierten Waren (be)nutzen. Da Bedürfnisse aber nicht so steigen können wie Entropie und Wert, entsteht eine systematische Überproduktion. Das ist der dritte Zusammenhang, der den Leser bei der Lektüre ständig begleiten muss: Die kapitalistische Welt ist zu voll mit zu vielen (nutzlosen) Dingen.
Im ersten von insgesamt sechs Kapiteln („Der Materialfluss“) wird unter anderem dieses Problem untersucht. Material und Energie, die durch den Produktionsprozess fließen, werden darin verbraucht und müssen hinterher in ihrer neuen Form konsumiert werden. Das geschieht zunächst, indem Nahrung gegessen, Kleidung getragen, Feuerholz verbrannt wird, danach also weg ist und erneuert werden muss. Das Potenzial dieser „Ströme“ ist begrenzt. Ein anderer Teil des Produkts fließt in langlebige Dinge, Häuser, Maschinen, Freizeitparks, Öltanker, Bergwerke, Produktionsanlagen. Eine Eigenschaft dieser „Bestände“ ist, dass sie bis zu einer gewissen Grenze überdimensioniert sein können, ohne dysfunktional zu werden, eine andere, dass sie lange existieren müssen, damit sie sich rentieren. Bestände schreiben Entwicklungspfade fest, beschleunigen aber auch den Gesamtprozess und vergrößern ihn mengenmäßig, weil ihr Erhalt und Erneuerung deutlich gesteigerte Investitionen wie auch Stoffströme verlangen, also sowohl mehr (Mehr-)Wert als auch mehr (Mehr-)Produkt aufnehmen können. Beide Elemente des Mehrprodukts, Ströme wie Bestände, lassen sich selbstverständlich auch dadurch vergrößern, dass man ihren Gebrauchswert verringert und ihre Gebrauchszeit verkürzt.
All das ist ökonomisch machbar und geschieht, aber der Vorgang ist damit von der materiellen Seite her noch nicht fertig beschrieben. Die besteht ja aus dem Verbrauch von konkretem Material, von Getreide, Sand, Metallen, Erdöl und der Beseitigung ihres Rests nach dem Gebrauch. Beides aber ist von der physikalischen Seite her endlich und bleibt es auch bei konsequentem Recycling. Sowohl die Vorräte an Rohstoffen und Energie, die „Quellen“, wie die möglichen Orte der Entsorgung, die „Senken“, werden nach und nach überfordert. Eine einzige Zahle kann das verdeutlichen: 104 Gigatonnen betrug die Menge an Materie, die 2023 aus der Erde extrahiert wurde, und übertraf damit beinahe die gesamte innerhalb eines Jahres nachwachsende Biomasse des Planeten (S. 172). Pineault entnimmt diese Zahl Arbeiten der relativ neuen Wissenschaft der Materialflussanalyse, deren Ergebnisse er umfassend nutzt, um die Dimension des Problems zu quantifizieren. Er ergänzt sie aber durch den hier eingangs dargestellten Rückgriff auf die Marx'sche Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesse und der entsprechenden Eigentumsordnung.
Das ist grundsätzlich einleuchtend und notwendig, erscheint aber manchmal ein wenig kursorisch. Auch die theoretischen Quellen, auf die er sich stützt, decken nicht alles ab, was in diesem Zusammenhang zu bedenken wäre, oder wären, wie etwa Paul A. Baran und Paul M. Sweezy, daraufhin zu befragen, inwieweit ihre Ergebnisse heute noch tragend oder nur für sich genommen aussagekräftig sind. Pineault ist sich durchaus bewusst, dass er noch nur erste Schritte unternommen hat zu etwas, das Simon Schaupp im Vorwort „Ideologiekritik mit naturwissenschaftlich-statistischen Methoden“ (S. 11) nennt. Man darf gespannt sein, was da noch kommt, wenn der erste Versuch schon derart beeindruckend war!