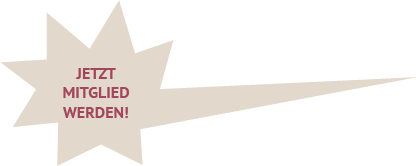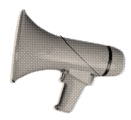Reform der Erbschaftsteuer – Nur Sommertheater?
Festzuhalten ist, dass die Steuerentlastungen für die Überreichen (übliche Definition: Investitionskapital über 30 Mio. Euro) während der letzten drei Jahrzehnte nicht die versprochene Wirkung hatte: Die Steigerung von Investitionsquote und Wirtschaftswachstum blieb aus, das Einzige was überdurchschnittlich wuchs, war der Reichtum der Reichen.
Üblicherweise ist die Besteuerung von Topverdienern und Reichen nur im Wahlkampf Thema und verschwindet dann umgehend von der Tagesordnung. Der Eindruck verfestigt sich, dass die politische Elite es nicht mehr schafft oder es auch nicht will, die Gruppe der Überreichen in relevantem Umfang zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben heranzuziehen. Dass das nicht immer gut geht zeigt das Beispiel der US-Demokraten. Seit Obama haben sie immer wieder von der Notwendigkeit der Reichenbesteuerung gesprochen – real umgesetzt wurde nichts, stattdessen sackten die Reichen Milliarde um Milliarde ein. Nun glaubt man ihnen nicht mehr und sie erlitten eine krachende Niederlage bei der letzten Wahl gegen jemanden, der ganz offen die Reichen reicher machen will. Von daher ist es ein riskantes Spiel, wenn Lars Klingbeil und die SPD das Thema Reichenbesteuerung nach dem Sommertheater wieder in die Schmuddelecke schieben würden. Der nächste Absturz bei den Umfragewerten wäre gewiss.
Die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung der Reichen an der Staatsfinanzierung führte neben den Reaktionen aus der Politik auch zum erwartbaren Aufschrei der Betroffenen und auch Teile der Wissenschaft fühlten sich berufen, die überaus nachteiligen Folgen einer solchen Maßnahme herauszustreichen.
Im Zentrum der Argumentation stehen dabei immer drei altbekannten Argumente: Eine stärkere Besteuerung der Weitergabe (Schenkung/Erbe) von Unternehmensbesitz würde
- durch Kapitalabzug die Innovationskraft der Unternehmen schwächen,
- insbesondere die Familienbetriebe und den Mittelstand und damit zentralen Elemente der deutschen Wirtschaft belasten und damit zu Firmenschließungen führen und
- zu einer Flucht der Reichen führen.
Zur Innovationskraft:
Die Besteuerung für Überreiche bezieht sich auf ihr Privatvermögen und treffen die ihnen gehörenden Firmen in keiner Weise. Für Mercedes war es egal, ob der Konzern der Familie Flick gehörte (die ihn verkauft hat) oder nun anderen Aktionär*innen. Auch der Aktienkurs von BMW verändert sich nicht, wenn die Erben der Geschwister Quandt in Zukunft ein Aktienpaket verkaufen und um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. Um grundsätzlich zu vermeiden, dass die Steuerzahlungen Auswirkung auf Unternehmensbewertungen haben, weil Eigentümer*innen Aktien oder Anteile verkaufen, schlagen wir außerdem vor, dass die Steuern auch durch die Übertragung von Unternehmensanteilen an eine Staatsholding beglichen werden können. Solch eine Staatsholding haben zum Beispiel Norwegen oder die Vereinigten Arabischen Emiraten schon lange. Stundungsmodelle mit einer Ratenzahlung für die Steuerschuld wären eine weitere mögliche Alternative.
Hinzu kommt ein folgender Gesichtspunkt. Die deutsche Wirtschaft leidet an grundlegenden Innovationen. Die Überreichen reinvestieren ihre Gewinne nicht in die nationale Realwirtschaft, wie die seit längerem zu beobachtende Investitionsschwäche zeigt. Neben Kapitalmarktspekulationen werden bestenfalls die althergebrachten Unternehmen weiterentwickelt während in disruptive Startups nur dann investiert wird, wenn der Staat als Sicherungsgeber mit einsteigt. Das ist keine typisch deutsche Entwicklung, sondern eine historisch feststellbare Tatsache, dass die Erbengeneration nicht immer das Unternehmerblut mitbekommt, sondern in der Regel auf Risikoabsicherung setzt, um das einmal erreichte zu erhalten und risikogemindert auszubauen.
Auch die Vorstellung, dass das Geld des Staates unproduktiv ausgegeben wird, während die Reichen investieren, ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Staatseinnahmen werden sofort als öffentliche Investitionen in Bahn oder Krankenhäuser oder als Gehälter an Erzieher*innen, Pflegepersonal oder Lehrer*innen wieder ausgegeben. Das belebt die Wirtschaft wie zur Zeit des Wirtschaftswunders, als auch die Reichen merkbar Steuern zahlten.
Zu den Familienunternehmen und dem Mittelstand:
In der Debatte um die Schenkungs- und Erbschaftsteuer wird ein Trugbild überaus effektiv eingesetzt: „Das Familienunternehmen“, das durch diese Steuer in Schwierigkeiten kommen könnte. Unwillkürlich denkt man dabei an eine Familie mit ihrem Betrieb, klassisch ein Handwerksbetrieb. Die bisher durchgesetzten Steuervergünstigungen kommen aber nicht diesen Unternehmen zugute, sondern westdeutschen Familiendynastien mit ihren Konzernen. BMW beispielsweise ist ein Familienunternehmen, da die Geschwistern Quandt mehr als 25% der Stimmrechte halten. Unter dem Label „Schutz der Familienunternehmen“ wurde dann in der Vergangenheit vor allem die Weitergabe (Schenkung/Erbe) großer Unternehmensvermögen von Steuerzahlungen massiv reduziert oder fast völlig befreit.
Gerade die Klein- und Mittelbetriebe unterliegen dagegen beim Generationenübergang höheren Steuerzahlungen. Oft hat die nachfolgende Generation kein Interesse an der Unternehmensnachfolge. Das Unternehmen wird dann verkauft und dieser Verkaufserlös unterliegt dann ungeschmälert der Erbschaftsteuer. Hier wirkt sich die Fehlkonstruktion der Freibeträge im Erbschaftsteuergesetz aus. Die Freibeträge sind nicht allzu hoch, erneuern sich aber alle 10 Jahre und beziehen sich auf den/die Schenkende*n bzw. Erblasser*in. Eine gezielt gesteuert Vermögensweitergabe kann daher durch die Erneuerung der Freibeträge eine steuerfreie Weitergabe an eine einzelne Person in mehrfacher Millionenhöhe ermöglichen, während beim einmaligen Erbschaftsfall ordentliche Zahlungen fällig sind. Dieser Punkt könnte durch eine Erhöhung des Freibetrages und Umstellung auf einen einmaligen Betrag beim Empfänger der Leistungen einfach und ohne Einnahmenverluste bei der Steuer korrigiert werden.
Zur Flucht der Reichen
In der letzten Zeit haben viele Länder im europäischen Umfeld Subventionen für die Reichen gekürzt oder Reichensteuern erhöht. Immer verbunden mit plakativen Medienberichten über die darauf folgende Abwanderung von betroffenen Reichen. In vielen Fällen konnte jedoch nachgewiesen werden, dass die Berichte völlig überzogen waren und zum anderen zeigen die Zahlen, dass die Steuereinnahmen real steigen.
In Falle Deutschland kommt hinzu, dass fast überall in Europa die Besteuerung für Reiche höher ist. Die Abwanderung müsste dann schon zu Steueroasen im nahen (z.B. Arabische Emirate) oder ferner (Singapur) Osten erfolgen. Ob aber dort das Vermögen dauerhaft sicher ist, kann mit einem dicken Fragezeichen versehen werden.
Hinzu kommt, dass die Reichen ihren Reichtum kaum mitnehmen können, wenn er in Investitionsobjekten wie Unternehmen oder Immobilien gebunden ist. Die Körperschaft- und Gewerbesteuerzahlung von BMW verringert sich nicht, wenn die Geschwister Quandt ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen würden. Sie selber zahlen ja kaum persönliche Steuern. Außerdem wäre bei einem Wegzug die gesetzliche Wegzugsteuer fällig, die in Falle dieses Geschwisterpaares mehrere Milliarden Euro betragen würde.
Die Erbschaftsteuer ist reformbedürftig – vor allem um ungerechtfertigte Subventionen abzuschaffen und Überreichtum gerecht zu besteuern, aber auch um bei einfachem Vermögensübergang eine Entlastung zu schaffen.
Eckpunkte für eine umfassende Reform der Erbschaftsteuer
- Die Empfänger von kleinen Erbschaften und Schenkungen, die gegenwärtig relativ am meisten abgeben müssen, werden entlastet. Für alle Erbschaften und Schenkungen an eine Person kommt ein hoher persönlicher Freibetrag zur Anrechnung. Erst wenn dieser aufgebraucht ist, ist eine Steuerzahlung fällig. Der bisherige Freibetragswildwuchs wird abgeschafft.
- Die heutigen Erbschaftsteuersätze werden beibehalten und durch weitere Progressionsstufen oberhalb von 100 Millionen Euro ergänzt.
- Die übermäßige Befreiung von Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer ist nicht begründet und entfällt. Die steuerliche Belastung der Erben von Klein- und Mittelbetrieben reduziert sich durch den obigen hohen Freibetrag. Bei großen Unternehmen werden in der Regel nur Unternehmensanteile vererbt oder in eine Familienstiftung eingebracht, da meistens mehrere Erbberechtigte vorhanden sind. Eine Aufteilung ist daher ohne weiteres möglich.
- Um eventuelle Liquiditätsprobleme der Erb-/Schenkungsempfänger zu vermeiden, ist darüber hinaus eine Ratenzahlung über max. 10 Jahre möglich.
- Die mit dieser Reform verbundenen erhöhten Steuereinnahmen könnten beispielsweise ins Bildungssystem eingebracht werden. Damit wird mehr für die Zukunftssicherung der deutschen Wirtschaft getan, als mit der ungezielten Subventionierung von Reichtum.
Download als PDF