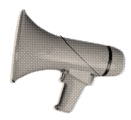Keine Verschwörung, sondern eine Art DNA – Katharina Pistors „Der Code des Kapitals“ entschlüsselt Kapitalismus und Globalisierung
Was Pistors Buch so lohnend macht, ist, dass ihre Analyse ‚geerdet’ ist, soll heißen: dass sie nicht von luftigen Begriffen wie Markt oder Staat ausgeht, sondern von ganz konkret nachvollziehbaren Handlungsmöglichkeiten und -strategien. Ein solches Vorgehen beansprucht zwar auch die ökonomische Theorie für sich. Doch zum einen macht sie dann so viele abenteuerliche Annahmen hinsichtlich der ‚Rationalität’ der Marktteilnehmer*innen, dass es auf deren Handeln dann doch nicht ankommt, sondern eine „unsichtbare Hand des Marktes“ Regie führt; und zum zweiten blickt die ökonomische Theorie typischerweise nur auf die Wahlentscheidungen, die innerhalb einmal festgesetzter Spielregeln getroffen werden. Mit anderen Worten: Sie blendet aus, dass reale Handlungsstrategien nicht zuletzt gerade darauf zielen, die Spielregeln selbst zu beeinflussen.
Die DNA des Kapitalismus und der Globalisierung
Eben hier setzt jedoch Pistor an, indem sie aufzeigt, was für viele überraschend sein dürfte: Anwält*innen entwickeln im Auftrag ihrer Mandant*innen Strategien, mittels derer bestimmte Güter rechtlich als Kapital ausgezeichnet („codiert“) werden. Sie richten ihre Fähigkeiten also darauf, die bestehenden Gesetze so ‚auszureizen’, dass jene Güter „und damit indirekt auch ihre Inhaber rechtliche Privilegien gegenüber anderen genießen“ (S. 189). Ohne diese „Codierung“ und die damit geschaffenen Privilegien „gäbe es weder Kapital noch Kapitalismus“ (S. 347). Beide sind demnach – als Ausdruck der rechtlichen Absicherung ungleicher Handlungsmöglichkeiten und der dadurch erleichterten oder gar verselbstständigten Erzeugung privaten Reichtums – keine ökonomischen, sondern politisch-rechtliche Phänomene; „der rechtliche Code des Kapitals folgt nicht den Regeln des Wettbewerbs; er operiert vielmehr gemäß der Logik von Macht und Privileg“ (190; s. auch S. 323 f.): „Das Kapital regiert, und es regiert durch das Recht“ (S. 321), ja durch ein im Laufe der Jahrhunderte geschaffenes „Imperium des Rechts“ (Kap. 1; S. 212, 287 s. auch 252, 261), das jedoch nicht auf einer großen Verschwörung beruhe. Seine Errichtung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung erforderten nämlich nur in Ausnahmefällen eine direkte Einflussnahme auf die Regierung bzw. den Gesetzgeber (S. 124 ff., 256, 338): Meist habe es genügt und genüge es, dass bestimmte Ansprüche einfach privat formuliert (also erhoben bzw. vertraglich vereinbart und zugleich als rechtlich einwandfrei dargestellt) werden, dass die Gerichte diese privat formulierten Ansprüche in einem möglichen Streitfall anerkennen und der Staat sie mit seinen Zwangsmitteln daraufhin durchsetzt – bzw. dass von den Anwält*innen glaubhaft gemacht werden kann, dass beides geschähe.
Entscheidend freilich: All dies gehe in erster Linie vom Recht und den Anwält*innen speziell Englands und des US-Bundesstaates New York aus; denn es sei gerade das Common Law dieser beiden Jurisdiktionen, das den privaten Anwält*innen überhaupt einen so großen Spielraum „bei der Herstellung des Rechts gibt. Denn diese sind nicht nur als Berater zum bereits existierenden Recht tätig, sondern formen aus dem alten Stoff ständig neue Rechte ...; alles, was sie tun müssen, ist, die argumentativen Strategien nachzuahmen, die die Gerichte auch schon in der Vergangenheit überzeugt haben, die Codierung neuer Güter zu billigen“ (S. 267). In den Zivilrechtssystemen nach Vorbild Deutschlands oder Frankreichs – und diesen Vorbildern folgen praktisch alle Länder, sofern sie nicht das System des Common Law übernommen haben (S. 212) – ist dies hingegen nicht so einfach, denn derartige Systeme „kategorisieren rechtliche Beziehungen, und ein Gericht beginnt bei der Überprüfung neuer Codierungsstrategien stets mit der Einordnung dieser Beziehungen in die bestehenden rechtlichen Kategorien“ (S. 271). Zwar billigten sie ebenso wie das Common Law „die Vertragsfreiheit, aber die Vertragsarten und besonders die Arten von Eigentumsrechten werden durch Gesetzesrecht ausgestaltet“ (ebd.). Hinzu kommt, „dass private Rechtsanwälte in den Ländern des Zivilrechtssystems später aufkamen als in England und nie die Art von Autonomie gegenüber dem Staat erlangt haben, die dort für diesen Beruf charakteristisch ist“ (S. 273).
Nicht zuletzt im Namen des Freihandels – und in der EU auch in dem Europas – erkennen jedoch auch die zivilrechtlichen Staaten zunehmend an, was in einem anderen Land, und damit speziell auch in England oder New York, „codiert“ wurde. Dies geschieht zum einen durch „Kollisionsregeln“, mit denen jeder Staat intern festlegt, wie er mit privatrechtlichen Ansprüchen aus anderen Jurisdiktionen umgeht (S. 26 f., 117 f., 215 f, 332, 351) und die zudem „so undurchsichtig sind, dass ihre Verabschiedung im täglichen politischen Prozess nur wenig Aufsehen erregt“ (S. 215); zweitens durch internationale Verträge; und drittens manchmal eben auch durch strategische Gesetzesänderungen (etwa beim Konkursrecht, das die Expansion der Finanzindustrie sonst stark behindert hätte, vgl. S. 230 ff.). Jedenfalls ist das Ergebnis weder ein weltweit harmonisiertes Recht – wie insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst angestrebt und innerhalb der EU auch in großem Maß verwirklicht (S. 214) – noch ein das Recht einheitlich durchsetzender Weltstaat, sondern ein „Flickenteppich“ (S. 283), der aber die Globalisierung gerade nicht behindert, sondern antreibt, denn „er erlaubt es denjenigen, die Bescheid wissen, sich die Regularien auszusuchen“ (S. 27). „Tatsächlich ist die Globalisierung das Produkt stark erweiterter Wahlmöglichkeiten für die Codierer des Kapitals.“ (S. 344) Pistor spricht auch von „Rechte-Shopping“ (S. 116 ff.; vgl. in diesem Sinne auch Supiot 2011), und jedenfalls seien es eben diese Wahlmöglichkeiten für die Codierer des Kapitals, die „die bemerkenswerte Vormachtstellung des englischen und des New Yorker Rechts bei der Codierung des globalen Kapitals“ (S. 216) erklärten.
Die allgemeine Struktur der rechtlichen „Codierung“ bestimmter Güter zu „Kapital“
Pistors Analyse ist nicht rein historisch oder gar anekdotenhaft, vielmehr arbeitet sie die immer wiederkehrende, allgemeine Struktur der „Codierung“ bestimmter Güter zu „Kapital“ recht genau heraus: Diese erfolge durch ganz bestimmte rechtliche „Module“, nämlich „das Vertragsrecht, die Eigentumsrechte sowie das Kreditsicherungs-, Trust-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht“ (S. 17, s. auch 7, 9, 327; im Einzelnen Kap. 2 bis 5), wobei das Trust-Recht praktisch nur in den Systemen des Common-Law existiert. Diese Module würden ganz bestimmten Gütern „aufgepfropft“ oder „übergestülpt“, denen dadurch ganz bestimmte „Attribute“ (S. 33) verliehen würden (S. 17 f., 33 ff., s. auch S. 255), nämlich „Priorität“ (also das mit dem Eigentumsrecht verbundene Verfügungs-Vorrecht), „Beständigkeit“ (in der Zeit), „Universalität“ (möglichst weltweite Durchsetzbarkeit gegenüber Dritten) und „Konvertierbarkeit“ (von „Privatgeld“ in „Staatsgeld“, dazu im nächsten Abschnitt unter „Schulden“).
Die bisher in Kapital verwandelten Güter
Güter auszuwählen und ihnen die genannten Attribute „überzustülpen ist gleichbedeutend damit, an den Hebeln für die Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft zu sitzen“ (S. 42). Folglich geht es aber auch nicht um beliebige, sondern eben ganz bestimmte Güter, die sich historisch wandeln bzw. ablösen.
- Grund und Boden (Kap. 2): Alle genannten Module seien ursprünglich entwickelt worden, um das Eigentumsrecht der englischen Landlords an dem von ihnen beherrschten Territorium sowohl gegenüber dem König wie den zuvor nutzungsberechtigten Bauern bzw. Nichtadeligen (Commoners) zu sichern (S. 58 ff.). Sie seien sodann aber auch von den Siedlern in den Kolonien eingesetzt worden (auch hier beanspruchte zunächst die Krone territoriale Souveränität), allerdings in Verbindung mit einer neuen Argumentationsstrategie gegenüber ihren Gegnern vor Gericht: Anders als im Fall der Landlords sei nun nicht das Senioritätsprinzip entscheidend (wer war zuerst da?), sondern dass erst sie, die Siedler, das Land „aufgewertet“ hätten (S. 63 ff., 201 f.). Durch das erworbene Eigentumsrecht an den Ländereien konnten diese nun außerdem als Sicherheit verwendet werden. Sie ermöglichten also insofern die Schuldenaufnahme, was somit weitere Codierungsstrategien zur langfristigen Vermögenssicherung anregte (s. auch S. 323): Um den Familienbesitz vor Gläubigern zu schützen, übertrugen ihn die Landlords einer Art Trust, dessen Nutzungsberechtigte sie waren und den sie gleichzeitig „im Namen und im Auftrag künftiger Generationen“ verwalteten (S. 68), so dass sie sich selbst das Recht nahmen, „das Recht auf eine Pfändung des gesamten Besitzes ... an einen Gläubiger ab(zu)treten“ (S. 68 f.; ähnlich beim späteren Trust, S. 78 f., zu weiteren historischen Vorläufern S. 79 f.). Krone und Parlament tolerierten dies angesichts der starken Stellung der Lords lange, während sie dies für die Kolonien nicht taten (S. 73 f., 76 f.), so dass die entsprechenden Rechtsmodule speziell in den USA erst deutlich nach der Unabhängigkeit erlaubt wurden, als sich auch dort eine Schicht von Vermögenden herausgebildet hatte (S. 74, 75 f.). In England hingegen wurden die Privilegien zum Schutz des Eigentums an Grund und Boden schließlich beseitigt, als im Laufe des 19. Jahrhunderts größere Summen für industrielle Investitionen benötigt wurden und die Landwirtschaft den Zollschutz verlor (S. 70 ff., 251 f.). Folglich konnten die Gläubiger ihre Forderungen vollstrecken: Das Finanzkapital wurde fortan zur „führenden Quelle privaten Wohlstands“ (S. 131) und insofern stellte sich das ganze System auf die Interessen der Gläubiger statt der Schuldner um (ebd.) – wobei sich beide zudem am Steuerzahler schadlos halten.
- Unternehmen (Kap. 3): Das Finanzkapital trat das Erbe von Grund und Boden als „Kapital“ jedoch nicht allein an, sondern gemeinsam mit den Unternehmen: Während Land wieder „in ein einfaches Gut verwandelt (wurde), eine einfache Ware, die nicht nur frei gehandelt werden, sondern auch leicht unter dem Hammer landen konnte“ (S. 72), wurden die Codierungsstrategien, die zum Schutz des Familienbesitzes der Landlords vor deren Gläubigern geschaffen worden waren, nun auch dazu verwendet, Unternehmen ebenfalls vor den Ansprüchen ihrer Gläubiger (einschließlich des Steuern erhebenden Staates) zu schützen. Dies geschieht in der Kapitalgesellschaft, die auf komplexe Weise dem Vermögensschutz (S. 98 ff.), der Verlustverschiebung (S. 104 ff.) und der Beförderung ihrer Unsterblichkeit (S. 112 ff.) dient. Diese Liste sollte sicher um die Funktion der generellen Abstreifung von Verantwortung auch für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verlängert werden.
- Schulden (Kap. 4): Als Gut betrachtet, sind Schulden ein vom Gläubiger gegen Geld erworbener Anspruch auf den Erhalt von Zahlungen; und bei ihrer „Codierung“ zu „Kapital“ – erneut mittels Weiterentwicklungen derselben Module (S. 135 ff., 144 ff.) – geht es darum (vgl. S. 129), dass derselbe Gläubiger diesen Anspruch einerseits mit Gewinn weiterverkaufen, er andererseits vom Schuldner aber auch jederzeit die Rückzahlung verlangen kann – nämlich sobald die Spekulationsblase platzt. In Bezug auf diesen Vorgang – das Verlangen der Rückzahlung –, spricht Pistor von der Konvertierung in „Staatsgeld“ (S. 36, 129), wobei sie unter „Privatgeld“ demgegenüber gerade die (aus Sicht des Gläubigers als Gut betrachteten) Schulden selbst versteht (S. 142, 151, 174). Das Nachsehen haben jedenfalls die nachrangigen Gläubiger und die Staaten bzw. Steuerzahler, die das System regelmäßig vor dem Absturz bewahren und dabei die Vermögenskonzentration weiter befördern (S. 131 f.). Dabei sei nicht einzusehen, warum die Staaten die Disziplin, die sie zur Verhinderung zu großer Inflation des Staatsgeldes inzwischen walten lassen, nicht auch auf den Bereich des Privatgeldes übertragen (S. 172 f., 174).
- Fachwissen (Kap. 5): Bei der rechtlichen „Codierung“ von Fachwissen zu „Kapital“ in Form geistigen Eigentums geht es nicht um den Schutz von Schuldnern vor Gläubigern oder umgekehrt, sondern um den Schutz vor Konkurrenz – Nachahmer eigener Innovationen, aber möglicherweise auch nur die ganz normale Konkurrenz, die man durch Erlangung des Schutzes von Scheininnovationen oder durch Aneignung der „Allmende“ (etwa des genetischen Codes) generell auszuschließen versucht. Dabei haben Patente, als eine wichtige Form des geistigen Eigentumsschutzes, aus Sicht der darum Bemühten den Nachteil, dass sie in jedem Einzelfall eine entsprechende staatliche Entscheidung voraussetzen und auch noch zeitlich begrenzt sind, weshalb stattdessen, bzw. zunehmend ergänzend, auch der gesetzliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Anspruch genommen wird (S. 202 ff.).
Die Bedeutung internationaler Verträge und Schiedsgerichte
Welche Rolle spielen internationale Verträge bei der Anerkennung des nach englischem und New Yorker Recht „codierten“ Kapitals durch die anderen Staaten?
Pistor beantwortet diese Frage insbesondere mit Blick auf die Investitionsschiedsgerichte, die durch die Auseinandersetzung um TTIP und CETA ja weithin bekannt wurden und auch von vielen Jurist*innen für nicht rechtsstaatlich und verfassungswidrig gehalten werden (vgl. etwa Broß 2015). Aus Sicht Pistors liegen sie vor allem im Interesse der Anwälte als „Herren des Codes“ und ihrer Mandant*innen, insofern es aus deren Sicht zu vermeiden gilt, dass ein staatliches Gericht ein negatives Urteil über die von ihnen vorgenommenen rechtliche Codierungstätigkeit fällt (S. 284). „Deshalb haben sie auch zunehmend darauf gedrängt, juristische Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen oder der Schiedsgerichtsbarkeit dem offiziellen Verfahrensweg gegenüber den Vorzug zu geben.“ (Ebd.) Und zwar durchaus auch im nationalen Rahmen, etwa wenn es um die Verletzung der Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern geht. Doch ihre eigentliche Durchschlagskraft erhält diese „Gerichtsvermeidungsstrategie()“ (S. 287) auf internationaler Ebene, wo die Staaten – möglicherweise aus ganz anderen Überlegungen heraus, aber jedenfalls sehr effektiv – drei Puzzlesteine geschaffen haben, die von den Anwält*innen nur noch zusammengesetzt werden müssen:
„Das erste Puzzleteil war das New Yorker Schiedsübereinkommen von 1958. Es stellt Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bereit für jene Parteien, die es vorziehen, ihre Streitigkeiten im Rahmen eines privaten Schiedsgerichtsverfahrens zu lösen, indem es ihnen zusichert, dass sie die Gerichte jedes Staates anrufen können, der dieses Übereinkommen ratifiziert hat, um ihre Schiedssprüche gegen auf ihrem Territorium befindliche Vermögenswerte zu vollstrecken.“ (S. 244) Spricht also ein Investitionsschiedsgericht – dessen Arbeitsweise in der Regel gegen die Mindestvoraussetzungen eines rechtsstaatlichen Verfahrens verstößt (vgl. Kahale 2018a, b) – einem Investor Schadenersatz möglicherweise in Milliardenhöhe zu, kann dieser ein Gericht am anderen Ende der Welt anrufen, welches, sofern der unterlegene Staat nicht von sich aus zahlt, verpflichtet ist, entsprechende Vermögenswerte dieses Staates in dem jeweiligen Land (zum Beispiel seine Botschaft) beschlagnahmen zu lassen und dem Investor zu übereignen.
„Das zweite Puzzleteil ist ein im Jahr 1966 in Kraft getretenes Abkommen, das das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) begründet hat. ... Länder, die die ICSID-Konvention unterzeichnen, akzeptieren damit, dass Streitigkeiten zwischen Staaten und Investoren vor einem privaten Gericht unter Schirmherrschaft des ICSID verhandelt werden und dass sie das Urteil akzeptieren müssen.“ (S. 245)
„Das dritte Puzzleteil ist das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge von 1969“ (S. 245), das in seinem Artikel 27 Satz 1 besagt: „Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen.“ Demnach gilt also: „Die Rechte, die Schiedsgerichte aus den dürren Worten bilateraler Investitionsverträge basteln, haben Vorrang vor innerstaatlichem Recht, auch vor der jeweiligen Verfassung eines Landes.“ (S. 246) Tatsächlich sei die Bedeutung der üblichen Bestimmungen, wonach ein Investor „fair und gerecht behandelt“ werden müsse und er auch nicht „indirekt enteignet“ werden dürfe, „nirgendwo definiert“ und bleibe sie also „den Schiedsrichtern überlassen, die vornehmlich aus der privaten Praxis kommen. Diese sind weniger an öffentlichen Belangen interessiert und haben darauf beharrt, dass das staatliche Recht, einschließlich des Verfassungsrechts, für die Vertragsrechts irrelevant sei. Artikel 27 des Wiener Übereinkommens verschafft ihnen effektive Rückendeckung dafür, in einem Streitfall ihre eigene Rechtsauslegung über das nationale Recht des Gaststaates zu stellen.“ (246)
Privatautonomie und Menschenrechte
Pistors Analyse zielt wesentlich darauf aufzuzeigen, dass Kapital und Kapitalismus und selbst die Globalisierung nicht unabhängig vom (National-)Staat, in einer vermeintlich rein ökonomischen Markt-Sphäre existieren, sondern nur in Verbindung mit diesem. Das ist zwar grundsätzlich nicht neu (vgl. etwa Offe 1975), in neoliberalen Zeiten aber dennoch geradezu ketzerisch. Jedenfalls garantiert nur der Staat die grundlegende, rechtliche Absicherung des Kapitals, und beim Platzen der Spekulationsblasen rettet er regelmäßig auch die ‚systemrelevanten’ Kapitalbesitzer.
Bedeutet dies aber auch, dass es durchaus in der Macht der Politik bzw. in unser aller Macht als Wählerinnen und Wähler stünde, die Dinge anders zu regeln? Pistors Antwort lautet letztlich Ja, aber wer ihr Buch nur oberflächlich liest, könnte an manchen Stellen auch zu einem anderen Schluss kommen. Der Grund ist, dass sie sich durchaus verständnisvoll mit dem Argument auseinandersetzt, dass die von ihr kritisierte rechtliche Privilegierung des Kapitals untrennbar mit dem Recht überhaupt verbunden sei; genauer gesagt: mit dem Umstand, dass das Recht und der Staat in den westlichen Ländern, wie von den Philosophen der Aufklärung gefordert, konsequent auf individuellen Rechten und dem Respekt der Privatautonomie gründen (vgl. S. 326 f., 335 ff., 357 ff.). „Die nationalen Rechtsordnungen, die im späten 18. Jahrhundert entstanden, bekräftigten die Unantastbarkeit der Privatautonomie, des Vertrags- und des Eigentumsrechts und stellten diese individuellen Rechte über andere, über die der Commoners“ (S. 341). Zudem werde es in diesen Rechtsordnungen häufig akzeptiert, wenn das Recht zwar durch allerlei Tricks unterlaufen, dabei aber formal eingehalten wird (S. 333). „In Rechtssystemen, die auf diese Weise eingerichtet sind, wird das Kapital auch weiterhin herrschen und das Recht sein wichtigstes Werkzeug bleiben.“ (S. 357)
Doch letztlich weiß auch Pistor, dass das nur die halbe Geschichte ist. In einer Fußnote zu der Aussage, dass die Verfassungsordnung „die subjektiven Privatrechte zu ihren Grundprinzipien erhoben hat“ (S. 327), stellt sie fest: „Das ist in Großbritannien und den USA der Fall. In anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, wurden konkurrierende Prinzipien, etwa das des Sozialstaats, als Gegengewicht zur Macht der subjektiven Rechte genutzt. Mit der Zeit hat sich der Schwerpunkt allerdings auf die Letzteren verlagert.“ (S. 433, Fn. 10)
Schienen eben noch die ganze Aufklärung, der liberale Verfassungsstaat und die Menschenrechte verfehlt zu sein – oder zumindest dazu zu zwingen, die Privilegierung des Kapitals kampflos hinzunehmen –, stellt sich die Sache tatsächlich also ganz anders dar: Aus deutscher und (kontinental)europäischer Sicht ist es geradezu trivial, dass wir an den Errungenschaften der Aufklärung festhalten und der Privilegierung des Kapitals trotzdem etwas entgegensetzen können – allerdings auch nur solange, wie wir verhindern, dass die verkürzte, angelsächsische Sichtweise auch bei uns Einzug hält bzw., noch wichtiger, über zu unkritisch im Namen Europas oder des Freihandels abgeschlossene internationale Verträge auch für uns verbindlich wird. Kurz: Wir müssen nicht das Recht abschaffen, sondern uns dessen erwehren, was man Neoliberalismus und neoliberale Globalisierung nennt.
Wie gesagt: Es geht hier nicht nur um eine verschrobene, spezifisch deutsche Sichtweise, sondern umgekehrt ist das angelsächsische Kurzschließen von individuellen Rechten und Kapitalismus erklärungsbedürftig und verwunderlich. Es ignoriert, dass die Geschichte der Aufklärung im Anschluss an die Unabhängigkeitserklärung der USA 1776 noch weiterging. Nicht nur hat Kant sie theoretisch weitergeführt, wodurch er zum Konzept der Menschenwürde gelangt ist, das als abwägungsresistentes, oberstes Prinzip etwa des deutschen Grundgesetzes praktisch geworden ist. Tatsächlich stammt „die erste Erklärung über universelle Rechte“ (Supiot 2011, S. 9) auch erst vom 10. Mai 1944, es war die „Erklärung über die Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation“ („Erklärung von Philadelphia“), die einen wichtigen Teil der Vorgeschichte der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und ihrer Annahme durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 bildete (vgl. a. a. O.). Mithin verdankt sich die Idee der Menschenrechte im heutigen Sinn – jener Rechte also, die im Rahmen der UN formuliert wurden und ab den 1960er Jahren auch völkerrechtliche Verbindlichkeit erlangt haben – nicht bloß den Kapitalinteressen, sondern wesentlich auch dem Kampf der Arbeiterbewegung um die Anerkennung der Rechte derjenigen, die mangels Kapital ihre Arbeit verkaufen. Sie sind deshalb gerade nicht auf ein Verständnis festgelegt, dass die sozialstaatliche, aber auch umweltpolitische und am Ende schlicht demokratische rechtliche Einhegung des Kapitalismus ausschlösse, ganz im Gegenteil. Vielmehr ist das gesamte System der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Absicht geschaffen worden, die internationale Zusammenarbeit in den Dienst der sozialen Gerechtigkeit zu stellen, bevor genau dieser Ansatz ab den 1970er Jahren vom Neoliberalismus aufgekündigt und angegriffen wurde (vgl. erneut und ausführlich Supiot 2011).
Das Recht als unverzichtbares Instrument der demokratischen Selbstregierung
So wenig leider Pistor diesen größeren Rahmen erläutert, so klar formuliert sie doch schließlich (S. 346 ff.) das entscheidende Problem: Die generellen, rechtlichen Privilegien des Kapitals (Pistor spricht vom „feudalen Kalkül“, S. 347 f.) stünden „in einem direkten Spannungsverhältnis zum Anspruch demokratischer Gemeinwesen, für die das Recht das wichtigste Instrument der kollektiven Selbstregierung ist.“ (S. 348)
Dies entspricht exakt dem, was auch stets die zentrale Kritik an CETA und Co. war, nämlich dass derlei Handelsverträge den Spielraum zur demokratischen Einhegung der Wirtschaft, also etwa der Sozial-, Umwelt- oder Verbraucherschutzpolitik sehr stark begrenzen (vgl. etwa Pinzler 2015; Köller/Waiz 2018).
Doch auch unabhängig von diesen neuen EU-Abkommen erkennt Pistor nicht weniger als eine „Entrechtung der demokratischen Wählerschaft“ (ebd.), worauf diese mit der Hinwendung zu rechtspopulistischen Angeboten reagiere (S. 348 f.). „Damit die Demokratie in kapitalistischen Systemen die Oberhand behalten kann, müssen die Gemeinwesen die Kontrolle über das Recht zurückgewinnen, das einzige Instrument, mit dem sie sich selbst regieren können, und das muss auch die Module des Codes des Kapitals beinhalten“ (S. 349).
Die Furcht der Politik und die Rolle der wirtschaftsliberalen Ideologie
Warum ist es aber – vor allem in den kontinentaleuropäischen Ländern mit sozialstaatlicher Tradition – überhaupt so weit gekommen? Auch Pistors Antwort auf diese Frage ist wieder wohl ‚geerdet’: Es ist nicht notwendig, eine große Verschwörung zu vermuten. Es reicht vielmehr die Annahme, dass die Politik sich auf das Spiel einlässt, weil neue Strategien der rechtlichen Codierung und Rechtssicherheit für neue Vermögenswerte zunächst einmal die Ausweitung der Kreditvergabe befeuern und damit das allgemeine Wirtschaftswachstum (S. 25 f., 44, 264). Außerdem springe die Politik in Krisenzeiten aus der Angst heraus bei, dass ansonsten auch das gesamte gesellschaftliche und staatliche System kollabieren könnte (S. 44, 321, 347).
Pistor erkennt beide Überlegungen im Prinzip durchaus an, doch sie besteht darauf, dass man zunächst vor allem im Hinblick auf die Frage, wem das allgemeine Wirtschaftswachstum denn wirklich zugute komme, sehr viel genauer hinschauen müsse, als es die herkömmliche ökonomische Theorie mit ihrem Vertrauen auf eine ominöse ‚unsichtbare Hand’ tue, da der ganze Prozess eben klar im Interesse der privaten Reichtumsproduktion der Kapitalinhaber vorangetrieben werde. „Wer immer behauptet, dass sich individuelle private Gewinne in einer Verbesserung des gesellschaftlichen Wohlergehens niederschlagen werden, sollte die Beweislast dafür übernehmen, die Mechanismen aufzuzeigen, mit denen dieses Kunststück vollbracht wird. Genug Gewinke mit der unsichtbaren Hand ... Wir brauchen echte Argumente und Beweise und keine Märchenerzählungen, um zu zeigen, dass die Gesellschaften, die den Rechtscode bereitstellen, auch ihren Anteil bekommen.“ (S. 350 f.) Sie selbst ist hier skeptisch und glaubt nicht an den von der wirtschafts- bzw. neoliberalen Theorie behaupteten Trickle-down-Effekt: „Sind die Forderungen von Kapitalinhabern erst einmal im Recht gegründet, dann sorgen sie für einen Trickle-up- und vielleicht auch für einen Trickle-round-Effekt, nämlich zugunsten anderer ambitionierter Vermögensinhaber rund um den Globus, allerdings ohne Garantie für irgendein Trickling-down.“ (S. 342, s. auch S. 322)
Juristische Tatsachen und politischer Wille
Die Politik hätte die Versprechungen der Ökonom*innen und der Kapitalvertreter*innen also deutlich kritischer prüfen sollen und sollte dies jedenfalls von nun an tun, doch sind durch die Versäumnisse in der Vergangenheit andererseits auch juristische Fakten geschaffen worden, die die Dinge nun erschweren: Das Zurückdrehen des Status quo bedeutet die Rücknahme des „Status von Eigentumsrechten oder ähnlichen Vorrechten“ für Vermögenswerte, so dass deren Inhaber nach Lage der Dinge Anspruch auf Entschädigung hätten (S. 349). „Und angesichts der Menge an Vermögen, das im Eigentums-, Kreditsicherungs-, Trust- und Gesellschaftsrecht eingebunden ist, dürfte eine friedliche oder finanziell tragbare Neugestaltung des Rechts durchaus nicht in greifbarer Nähe sein.“ (S. 349 f.) Allenfalls könnte eine weitere Finanzkrise wie die von 2007/2008 ein entsprechendes Gelegenheitsfenster bieten (S. 349).
Freilich: Wenn die Kapitalseite das Rad überdreht, sägt sie sich den Ast ab, auf dem sie sitzt, nämlich die Legitimität des Staates und des staatlichen Rechts (S. 47). Insofern dürfte es am Ende auf den politischen Willen bzw. entsprechenden Druck seitens des Wahlvolks ankommen.
Pistors Neun-Punkte-Programm
Tatsächlich skizziert Pistor (S. 350 ff.) am Ende auch ein Neun-Punkte-Programm, das von der Überlegung ausgeht, es gelte zweierlei zu tun (S. 350): „die Kontrolle der derzeitigen Vermögensinhaber und ihrer Anwälte über den Code des Kapitals zurückzudrängen“ (durch Begrenzung der Wahlmöglichkeiten), und den bisher Benachteiligten besonderen rechtlichen Schutz zu gewähren. Allerdings sind die Ausführungen zu diesem zweiten Aspekt nur sehr knapp und auf den neunten Punkt begrenzt.
1.: Erstens müsse damit aufgehört werden, „dem Kapital über die grundlegenden Module des Codes hinaus noch weitere rechtliche Privilegien anzubieten“ (S. 350), beispielsweise durch Abschluss von Freihandels -und Investitionsschutzverträgen.
2.: „Als nächstes sollte die Wahl der Rechtsordnung, die für die eigenen Interessen am günstigsten ist, erschwert werden. Einige mögen diese Maßnahme als Protektionismus anprangern; tatsächlich ergibt sie sich aber aus den Grundprinzipien der demokratischen Selbstregierung“ (S. 351), denn diese erfolge mittels des Rechts und sei also ineffektiv, wenn manche sich ihr entziehen könnten. Jedenfalls könnten die Kollisionsnormen prinzipiell „von einem Staat nach dem anderen wieder zurückgenommen werden“ (S. 351), wobei es aber durchaus „Raum für eine wechselseitige Anerkennung unter den Staaten zur Vermeidung doppelter Regulierungsmaßnahmen und -belastungen“ geben sollte (ebd.). Und: „Übrigens könnte die Einschränkung der Wahl des Gründungsorts für ein Unternehmen eine wirksamere Waffe gegen die Steuerflucht darstellen als das Blacklisting von Ländern“ (S. 352, vgl. auch S. 121 ff., zur Freiheit der Wahl des für die eigene Kapitalgesellschaft geltenden Rechts vgl. auch 91 ff., 116 ff.; zur Umgehung von Regulierungen S. 124 ff).
3.: Das Ausweichen auf Schiedsgerichte statt staatlicher Gerichte sollte nur möglich sein, wenn diese nicht „über Fragen von gesellschaftlichem Interesse befinden sollen, wie dies bei Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten der Fall ist, wenn sie in wichtige politische Fragen wie das Kartellrecht oder in andere Regulierungsbereiche eingreifen oder wenn sie Fälle zwischen Parteien mit höchst ungleicher Verhandlungsmacht entscheiden, zum Beispiel ... zwischen Unternehmen und Verbrauchern.“ (S. 352)
4.: Die durch das Platzen der Spekulationsblase ausgelösten Krisen müssen „proaktiv bekämpft werden“ (S. 352), ansonsten sei dies eine Einladung an die Spekulanten, sich auf staatliche Rettungsaktionen zu verlassen (S. 353).
5.: „Um der Tendenz des Kapitals entgegenzuwirken, seinen Einfluss auf Gesetzgeber und Regulierungsbehörden wiederzuerlangen, sind neue Mechanismen erforderlich, die denjenigen eine Stimme geben, die in einer Krise am meisten zu verlieren haben. Dazu kann es gehören, die betroffenen Parteien zu ermächtigen, im Nachhinein Schadenersatz zu fordern, und zwar in finanziellen Größenordnungen, die eine effektive abschreckende Wirkung entfalten können. Hierbei muss das Rad nicht neu erfunden werden“ (S. 353).
6.: „Sechstens sollten uralte Limitierungen der Kapitalcodierung, die im Laufe der Zeit abgebaut wurden, wiederbelebt werden.“ (S. 354; vgl. ebd.)
7.: „Solange eine bedeutende Anzahl von Ländern einige Änderungen in die oben vorgeschlagene Richtung vornimmt, würden sich die Dinge schon verbessern.“ (S. 355) Wegen ihrer besonderen Bedeutung sollten im Idealfall England und New York/USA die Führung übernehmen (ebd.).
8.: „Wenn die Anwälte wirklich unabhängig werden wollen vom Kapital, dann müssen wir noch einmal gründlich darüber nachdenken, wie die juristische Ausbildung finanziert werden kann und wie man die Entlohnung in führenden Kanzleien strukturiert.“ (S. 356 mit Blick insbesondere auf die Verhältnisse in England und USA)
9.: Was schließlich die Codierung neuer Rechte für die bisher Benachteiligten angeht, sei hier entscheidend, dass dadurch der politische Charakter der Entscheidungen über den Wert eines Vermögensgegenstandes sichtbar werde: Solche Gegen-Codierungen würden „die entscheidende Rolle des Rechts bei der Festlegung des Werts eines Vermögensgegenstandes sichtbar machen, aber auch aufzeigen, dass die Macht, über die Inhalte des Rechts zu bestimmen, letztlich beim Volk als dem Souverän demokratischer rechtsstaatlicher Systeme liegt“ (S. 364).
Neue Herausforderungen
Angesichts der geopolitischen bis imperialen Ambitionen des stärker und stärker werdenden Chinas sowie der neuen Ost-West-Konfrontation, die daraus erwächst und wohl schon begonnen hat, kann man fragen, was dies für den von Pistor analysierten, bisherigen Status quo – das auf dem englischen und dem New Yorker Recht basierende, globale „Imperium des Rechts“ – bedeutet. Diese Frage untersucht die Autorin nicht.
Einer anderen, neuartigen Herausforderung widmet sie jedoch sehr große Aufmerksamkeit (Kap. 8), nämlich der Frage, inwiefern der digitale Code den rechtlichen Code ablösen könnte, denn Technologien wie die der Blockchain erlaubten Verträge, die ihre eigene Durchsetzung selbst schon beinhalteten, so dass der Staat als starker Dritter, der diese Durchsetzung im Zweifelsfall garantiert, verzichtbar werde. Vor diesem Hintergrund weist sie zunächst darauf hin, dass dieser Ansatz keineswegs halten könne, was er verspreche (letztlich weil ein digitaler Algorithmus nicht in der Lage sei – genauso wenig wie ein herkömmlicher Vertrag oder ein Gesetz –, alle Eventualitäten vorauszusehen); und sie sagt auch voraus, dass auch der digitale Code letztlich wieder rechtlich eingehegt werde. „Aber inzwischen habe ich meine Meinung geändert“, so Pistor in einem Interview: Sollten Pläne wie die Facebooks für eine eigene Währung Realität werden und Facebook also „mit dem Wert unserer Daten für seine Währung einsteht, dann hat man eine neue Quelle für Souveränität.“ (Ebd.)
Katharina Pistor (2020): „Der Codes des Kapitals. Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft“, Berlin: Suhrkamp.
Literatur
Broß, Siegfried (2015): Freihandelsabkommen, einige Anmerkungen zur Problematik der privaten Schiedsgerichtsbarkeit. In: Report der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 4, Januar, Düsseldorf.
Kahale, George III (2018a): ISDS: The Wild, Wild West of International Practice. Lecture Delivered at Brooklyn Law School on April 3, 2018. In: Brooklyn Journal of International Law 44, S. 1-10.
Kahale, George III (2018b): Rethinking ISDS. In: Brooklyn Journal of International Law 44, S. 11-50.
Köller, Thomas/Waiz, Eberhard (2018): CETA & Co. und die Zukunft der Demokratie. Gespräche mit Andreas Fisahn, Hans-Jürgen Blinn und Rainer Plaßmann. Düsseldorf: Verlag Neue Aufklärung.
Pinzler, Petra (2015): Der Unfreihandel. Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Supiot, Alain (2011): Der Geist von Philadelphia. Soziale Gerechtigkeit in Zeiten entgrenzter Märkte. Hamburg: Hamburger Edition.
Offe, Claus (1975): Berufsbildungsreform. Eine Fallstudie über Reformpolitik, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Autor
Thomas Köller, Dr. rer. pol., ist Lehrbeauftragter an der FH Dortmund und Mitglied im Attac-Rat.
Download als PDF