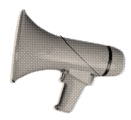Grundeinkommen statt Urheberrecht? Zum kreativen Schaffen in der digitalen Welt
Obwohl ich selbst unter anderem als Autor tätig bin, war für mich bisher die Debatte um das Urheberrecht ziemlich unübersichtlich. Ilja Brauns Buch schafft da einen guten Überblick, und zwar entlang der Frage, wie Autoren und Autorinnen denn zu einem akzeptablen Einkommen gelangen sollen. Dass dies heutzutage nicht der Fall ist, ist allgemein bekannt, obwohl das Urheberrecht doch eigentlich genau das ermöglichen soll. Indem die SchöpferInnen ein (Eigentums)Recht an ihrem Werk haben, sollen sie durch dessen Verkauf ihren Lebensunterhalt verdienen können. Tatsächlich gelingt dies kaum einer schreibenden Person.
Wovon sollen Kreativschaffende leben, wenn nicht vom Urheberrecht“, fragt Braun (S. 143) und geht die wichtigsten Lösungsvorschläge durch, die diesbezüglich gemacht werden. Alle haben Defizite, auch wenn deutlich wird, dass „Eigentumsschutz und Umverteilung einander zuwider“ laufen (S. 141). Das hat wesentlich damit zu tun, dass für Urheberrechte zwar viel bezahlt wird, aber der Großteil nicht bei den Schreibenden ankommt, sondern „bei allerlei Gatekeepern und Vermittlern…, bei Verlagen, Labels, Portalen, Shops“ (S. 136) hängen bleibt. Außerdem erhalten wenige Stars über 80 Prozent der Gesamteinnahmen aller Kreativen, die Masse muss sich die restlichen 20 Prozent teilen. „Wer erreichen will, dass mehr Kreative von ihrer Arbeit leben können, wird nicht umhin kommen, einen Mechanismus zu etablieren, der sicherstellt, dass ein Teil des Geldes, das heute für Urheberrechte ausgegeben wird, zukünftig in die Produktion von Werken investiert wird, die sich nicht am Markt rentieren.“ (S. 140)
Damit sind wir bei dem Punkt, der dieses Buch weit über die schreibende Szene hinaus bedeutsam macht, bei den Arbeits- und Produktionsbedingungen. Die Herstellung der rein materiellen Seite des gesellschaftlichen Reichtums wird mit zunehmender Produktivität der Arbeit immer einfacher; immer weniger menschliche Arbeitszeit muss dafür investiert werden. Im konkreten Produkt sind die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse in dreifacher Weise verborgen: Es ist kaum noch sichtbar, wer welchen Arbeitsanteil dazu beigetragen hat; die Entlohnung der unmittelbaren ProduzentInnen folgt in gar keiner Weise ihren konkreten Produktionsanteilen und der Preis des Produkts ergibt sich keinesfalls aus dem irgendwie ermittelten durchschnittlichen Arbeitsaufwand für seine Herstellung, sondern folgt dem, was die Kunden bereit und in der Lage sind, dafür zu zahlen.
Sicherlich gilt diese Darstellung nicht für alle Waren in gleicher Weise, bei einem einfachen Werkzeug wie einem Schraubenschlüssel mag die Produktionszeit noch preisbestimmend sein, bei einem Stuhl ist das schon zweifelhaft und beim Smartphone, das Braun als Beispiel wählt, ist seine Argumentation überzeugend: „Wer heute ein Smartphone kauft, tut dies nicht wegen der technischen Funktionalität des Geräts und wohl nur begrenzt wegen der Marke, sondern wegen des Zugangs zu potenziell unerschöpflichen Sphären der Kommunkation und Vernetzung, die der Besitz des Geräts ihm zu eröffnen verspricht.“ (S. 164)
Hier könnte man hinzufügen, dass solche Produkte dadurch die Rolle eines „positionellen Gutes“ erhalten, also eines Produkts, das etwas über die Rolle seiner Besitzerin oder seines Besitzers im gesellschaftlichen Gefüge aussagt. Unter diesem Gesichtspunkt wären eine ganze Reihe moderner Gebrauchsgegenstände auch auf ihre Funktion in der Wachstumsökonomie hin zu betrachten. Sie stellen eine permanente Verstärkung des der kapitalistischen Wirtschaft ohnehin immanenten Wachstumszwangs dar, indem sie die Individuen animieren, ständig das neueste Modell besitzen zu wollen, besser zu „müssen“, wenn sie denn dazugehören wollen. Ilja Braun erwähnt das nicht ausdrücklich, sieht aber als Konsequenz völlig klar, dass „‚Innovationen‘ und ‚Geschäftsmodelle‘ am laufenden Band entwickelt werden (müssen), weil das Produkt, das Firmen in Wirklichkeit verkaufen, wesentlich immateriell ist. Das setzt voraus, dass auch die Arbeit, in welcher Weise auch immer die Unternehmen sie sich aneignen, mehr ist als Dienst nach Vorschrift. Um produktiv zu sein, darf sie sich nicht mehr in der Erfüllung vordefinierter Aufgaben erschöpfen, sondern muss kreative Arbeit werden…Die Art und Weise, wie Künstler arbeiten, ist zur Blaupause für die Arbeit im postindustriellen Zeitalter geworden.“ (Ebda.)
Netzwerkökonomie findet nicht nur im digitalen Kernbereich statt. Unternehmen schreiben Augaben als Allerkleinstjobs aus, auf die man sich bewerben kann, etwa für Textkorrekturen oder anderes. Der Mechanical-Turk-Service von Amazon ist ein Beispiel dafür, „eine Art digitaler Sweatshop“. Die Aufgaben sind in wenigen Miuten erledigt und werden mit Centbeträgen entlohnt – wenn ihre Ergebnisse denn gekauft werden. Das ist nicht immer der Fall, weil die Aufträge oft offen ausgeschreiben werden; viele senden Lösungen ein und das Unternehmen zahlt nur eine. Amazon wirbt: „Sie zahlen nur das, was sie auch tatsächlich nutzen.“ Im Rahmen dieses sogenannten „Cloudworking“ plant IBM seit 2012 ein IBM-Liquid, um auf kollaborativen Plattformen Entwicklungsprojekte auszuschreiben. „Die eigene Belegschaft wird entsprechend abgebaut. Allein in Deutschland sollen dazu bis zu 20 000 Stellen verloren gehen.“ (S. 160f)
Die Unternehmen kaufen nur noch bedingt Arbeit(szeit) ein, sondern im wesentlichen Kreativität. Zu deren Aneignug brauchen sie oft nicht einmal mehr Arbeitsverträge anzubieten. „Mitunter schließen sie nur noch projektbezogene Verträge mit freiberuflichen Mitarbeitern, doch oft nehmen diese nur Koordinationsaufgaben wahr. Es ist ein Kennzeichen der Netzwerkökonomie, dass die Grenzen zwischen individueller Freizeit, freiwillig geleisteten Beiträgen im Rahmen unterschiedlicher Communities und freiberuflicher Erwerbsarbeit verfließen.“ S.161f) Der Autor, ehemaliger Mitarbeiter der Bundestags-Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“, weiß: „Mittlerweile hat der digitalisierte Arbeitsplatzabbau die Mittelstandsbrufe erreicht. Schon heute werden viele Aufgaben, die klassischerweise Sekretärinnen übernommen haben, von Computerprogrammen erledigt. Automatische Übersetzungen sind handhabbar geworden und Computer sind in der Lage, kurze Berichte über Fußballspiele zu schreiben. Übrig bleiben schlecht bezahlte Dienstleistungen, von der Pizzabäckerei über die Kinderbetreuung bis zur Fahrerei.“ (S. 167) Auto fahren können Computer inzwischen auch, möchte man hinzufügen.
Es ist das große Verdienst des Buches, die Existenz solcher Arbeitsverhältnisse und die Tendenz ihrer zunehemden Etablierung deutlich herausgearbeitet zu haben. In einer solchen Ökonomie ist die Vorstellung, soziale Sicherheit durch Vollzeiterwerbsarbeit herzustellen, ein purer Anachronismus. Da hilft auch keine Arbeitszeitverkürzung, weil im Rahmen der Netzarbeit die Tätigen die Zeit ihres Tätigseins selbstständig und ohnehin entgrenzen. Ilja Brauns Fazit ist einschränkungslos zuzustimmen:
„Es geht nicht darum, ein bedigungsloses Grundeinkommen als sozialen Ausgleich einzuführen, aus dem Gedanken der Sozialpflichtigkeit des Eigentums heraus, oder, was ungefähr dasselbe ist, als Almosen, das die Leistungsträger den Minderleistern zahlen sollten. Es geht nicht um einen Ausgleich der Ergebnisse von Marktgerechtigkeit durch soziale Gerechtigkeit…Sondern es geht darum, von jenen, die mit der (Aneignung der – WR) kollektiven Kreativität und Intelligenz Gewinne einfahren, den eigenen Anteil einzufordern.“ (S. 169)
Ilja Braun
Grundeinkommen statt Urheberrecht? Zum kreativen Schaffen in der digitalen Welt
transcript Verlag Bielefeld 2014
192 Seiten, 21,99 €
ISBN 978-3-8376-2680-3
Download als PDF