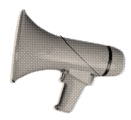Globalisierung und Globalisierungskritik: Auf der Höhe der Zeit?
- Es gibt seit einiger Zeit zahlreiche Ansätze, Globalisierungskritik neu zu fassen oder zumindest zu schärfen. Die sind, soweit wir das bisher überblicken, selten umfassend, betreffen meist nur Einzelaspekte. Anders als um die Jahrtausendwende ergibt sich aus den vielen Einzelstimmen bisher kein erkennbares Konzert. Die damals absehbare Konzentration auf ein shareholdervaluezentriertes Akkumulationsregime war richtig, weil sie das Neue und Typische der damaligen Phase der Globalisierung in den Blick nahm. Sie ist auch heute noch nicht falsch, aber sie erfasst einige neuere Phänomene nicht mehr und ist auch nicht mehr d a s charakteristische Merkmal der Zeit.
- Attac D hat spätestens mit der Düsseldorfer Erklärung im Oktober 2008 die kurz zuvor offensichtlich gewordene Krise als systemisch beschrieben und ihren Kern darin gesehen, dass die Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals misslingt. Keineswegs alle von uns hätten diese marxistische Begrifflichkeit dafür gewählt, einige hätten sie vielleicht nicht einmal verstanden, aber es bestand Einigkeit darin, dass es zu viel Kapital für zu wenige profitable Anlagemöglichkeiten gab. Es war klar, dass einige, vielleicht sogar wichtige, Korrekturen zwar nötig wären, aber nicht mehr ausreichen würden, sondern dass ein grundsätzliches Umsteuern erforderlich sein würde. Dennoch blieb vage, was genau kritisiert wurde, der Neoliberalismus oder der Kapitalismus als solcher.
- Das ist auch bis heute nicht eindeutig, nicht einmal da, wo ausdrücklich der Kapitalismus als das Problem benannt wird. Nochmals marxistisch gesprochen ist nicht bei allen Äußerungen zu erkennen, ob Kritik und Forderungen darauf hinauslaufen, die Akkumulation des Kapitals als solche, als Modell, anzugreifen und abzuschaffen, also eine Ökonomie ohne Kapital zu errichten, oder darauf, die Regeln für die Akkumulation von Kapital so zu verändern, dass es in großem Umfang zur Finanzierung gesellschaftlich notwendiger Aufgaben herangezogen werden könnte, also das Akkumulationsregime zu erneuern. Ich habe den Eindruck, dass auch viele Kritiker*innen sich über den Unterschied nicht bewusst sind oder ihn für belanglos halten.
- Vor allem wenn allgemein um die Ökologie- und ganz speziell um die Wachstumsproblematik geht, ist die Antwort auf diese Frage aber von zentraler Bedeutung. Die Notwendigkeit der Kapitalakkumulation als solcher führt dazu, dass eine Steady-state-Ökonomie auch dann nicht machbar wäre, wenn die entsprechenden Mehrheiten und der politische Wille dazu da wären. Verschiedene Autor*innen haben das in den letzten Monaten und Jahren ausgeführt, nicht zuletzt Ernst Lohoff/Norbert Trenkle („Shutdown“), Tomas Konicz („Klimakiller Kapital“) und Matthias Martin Becker („Klima, Chaos, Kapital“), die ja alle in der Attac-Diskussion immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. Eine ökologische Ausrichtung des Kapitalismus, „grüner Kapitalismus“, ist eine Illusion. Diese Einsicht trennt uns faktisch von einem sehr großen Teil unseres politischen Umfeldes, nämlich vom gesamten grünen, fast dem ganzen sozialdemokratischen und einem großen Teil des LINKEN-Milieus.
- Es ist aber nicht einfach, zu bestimmen, was das praktisch bedeutet. Der Neoliberalismus ist zwar als ökonomische Theorie gescheitert, aber nicht aus der Welt verschwunden. Als Herrschaftsregime ist er im Gegenteil sehr präsent und wirkmächtig, sodass der Widerstand dagegen eine tagespolitische Aufgabe bleibt, die uns wiederum mit großen Teilen der oben genannten Milieus verbindet.
- Auch ein wesentlicher Teil der ökonomischen Kritik am Neoliberalismus bleibt bestehen. Sein Einsatz bestand ja im Gegensatz zu früheren Akkumulationsregimes darin, nicht in erster Linie die Herstellung des Mehrprodukts zu verändern, sondern die Aneignung, also die Verteilung des aus ihm entstandenen Mehrwerts. Dieser Prozess wird durch die Plattformisierung der Ökonomie ja nicht nur nicht außer Kraft gesetzt, sondern dramatisch beschleunigt, oft so weit, dass die Gebrauchswerte der Produkte fraglich werden, wie wir es etwa in allen Bereichen der sozialen Reproduktion sehen können. Auch hier haben uns nahestehende Autor*innen Wegweisendes zu geschrieben, u. a. Florian Butollo/Sabine Nuss („Marx und die Roboter“), Timo Daum/Sabine Nuss („Die unsichtbare Hand des Plans“), Moritz Altenried/Julia Dück/Mira Wallis („Plattformkapitalismus und die Krise der sozialen Reproduktion“).
- Die Coronakrise tut ein Übriges, indem sie tief in die Struktur der kapitalistischen Produktion eingreift. Weder ist mehr der Nachschub an Vorprodukten noch an Arbeitskräften gewährleistet. Auch die Klimakrise wirkt strukturell gegen eine Weltwirtschaft, die auf derart viel und regelmäßigen Transport angewiesen ist wie die aktuelle. Zusammen mit dem immer schon prekären Zugriff auf Rohstoffe, der sich freilich für alle Teile des Weltkapitals jeweils unterschiedlich gestaltetet, ergibt sich so eine veritable Unsicherheit, ob der neoliberal geformte Kapitalismus überhaupt noch die Produktion in gewünschtem und profitabel möglichen Umfang aufrecht erhalten kann. Das macht die obige Äußerung, der Neoliberalismus existiere nach wie vor als Herrschaftsregime, um so brisanter.
- Das Militär in den großen imperial agierenden Ländern ist sich dieser Brisanz sehr früh bewusst gewesen. Sowohl in den USA wie in Deutschland oder auch in Großbritannien gab es schon vor Jahrzehnten Studien zur Bedeutung des Klimawandels aus den Reihen des Militärs, die oft präziser und ehrlicher waren als von manchen Forschungseinrichtungen. Die Absicht dieser Papiere und ihrer Autoren war es nicht, die Klimakrise zu verhindern, sondern bestenfalls sie so weit zu entschärfen, dass ihre Folgen sicherheitstechnisch beherrschbar blieben. Dabei ist selbstverständlich die geostrategische Rolle des Militärs auch im Zusammenhang mit den geopolitischen Verschiebungen im Weltmarkt von besonderer Bedeutung. Man darf das nicht missverstehen: Es geht dabei durchaus auch darum, welcher Staat/Machtblock welchen Einfluss global geltend machen kann. Vor allem aber geht es um die Garantie des Fortbestandes eines Systems, von dem alle Herrschaftsapparate profitieren und leben. In diesem Sinne bleibt Krieg eine dauernde, tagtägliche Option, aber nur ganz unwahrscheinlich zwischen den großen Akteuren. Krieg bleibt „Weltordnungskrieg“ (Robert Kurz).
Das hier Beschriebene ist noch sehr unvollständig und ebenfalls nur recht grob gezeichnet, geht aber selbst damit schon weit über den common sense in Attac hinaus, in einigen Punkten widerspricht es wahrscheinlich sogar explizit dem Zugang einiger Attacies. Wäre es nicht schon schwierig genug, diese Widersprüche zu bearbeiten, so wird das Problem nochmals verschärft dadurch, dass die von mir gelieferte Darstellung nur als ganze Sinn ergibt. Teile rauszubrechen, würde sie zerstören.
Das kann, muss aber kein Unglück sein. Attac hatte auch in seiner Frühzeit solche strukturellen Widersprüche. Unser Umgang damit war, sie nicht zu diskutieren. Wir wussten voneinander, wie wir da jeweils dachten, und haben nicht versucht, darüber Einigkeit herzustellen. Stattdessen haben wir gemeinsame Forderungen entwickelt und dafür unterschiedliche, sich teilweise sogar direkt widersprechende Begründungen zugelassen. Ob diese Methode heute noch anwendbar ist, bezweifle ich zwar, schließe es aber nicht aus, schon gar nicht vor dem Versuch.
Download als PDF