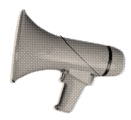Die solidarische Gesellschaft als Alternative zur Wettbewerbsgesellschaft mit Wachstumszwang
Eine von neoliberaler Ideologie geprägte Wirtschaft und Gesellschaft kann die großen Umweltprobleme unserer Zeit wie übermäßigen Ressourcenverbrauch und Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Die Gründe hierfür werden in den folgenden Absätzen über Wachstumszwänge und soziale Ungleichheit dargestellt.
Nur wenn ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Alternativen umgesetzt werden, ist eine nachhaltige Entwicklung möglich, die die Grenzen des Wachstums respektiert. Exemplarisch werden hierzu vier in den letzten Jahren entwickelte Konzepte vorgestellt: Konvivialistisches Manifest, Care Economy, Inklusion und Gemeinwohlökonomie.
Abschließend werden Beiträge zusammengefasst, die in der Diskussionsphase eines gleichlautenden Workshops auf der Attac-Sommerakademie 2015 entstanden sind.
1. Neoliberale Ideologie und Wachstumszwang
Wettbewerb und soziale (Einkommens- und Status-) Ungleichheit sind zentrale Elemente der neoliberalen Ideologie. Das Menschenbild des Neoliberalismus ist der homo oeconomicus, der danach strebt, mehr Besitz und einen höheren sozialen Status zu erreichen. Ohne permanenten Wettbewerb würde Leistung unterminiert und der Anreiz zur Weiterentwicklung entfallen. Mitmenschlichkeit und Solidarität werden als rückständige Instinkte betrachtet. Der Wohlfahrtsstaat mit umfassendem Sicherungssystem wird konsequenterweise abgelehnt, weil er falsche Anreize setze, durch die Selbstverantwortung und Eigeninitiative behindert würden.
Die neoliberale Politik hat weltweit zu Umverteilung von Einkommen und Vermögen von unten nach oben geführt. Allein in Deutschland haben zwischen 2000 und 1014 die abhängig Beschäftigten 1,2 Billionen € eingebüßt, die Empfänger von Kapitaleinkünften wurden in derselben Höhe reicher (Schuhler 2015,1). Die dadurch gewachsene soziale Ungleichheit hat gravierende soziale und ökologische Konsequenzen, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
2. Einkommensungleichheit und Wachstumszwang
Die Sozialwissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett (2010) haben sich in ihren Forschungen mit den Folgen von Einkommensungleichheit befasst. Ungleichere Gesellschaften haben eine kürzere Lebenserwartung, mehr psychische Erkrankungen und Drogenprobleme, mehr Kriminalität und Gefängnisstrafen, schlechtere schulische Leistungen der Kinder und eine geringere soziale Mobilität. Neben den gesundheitlichen und sozialen Folgen von Einkommensungleichheit haben die AutorInnen auch Umweltfolgen untersucht und dabei festgestellt, dass es zwischen Umweltverbrauch/Umweltbelastung und sozialen Standards keine zwangsläufige Beziehung gibt: Costa Rica und Kuba haben trotz wesentlich geringeren CO2-Ausstoßes keine größere Säuglingssterblichkeit als große Emittenten wie USA, Kuwait oder Bahrein.
Kuba hat wegen des guten Bildungssystems und der guten Gesundheitsversorgung einen relativ hohen Human Develpment Index (HDI), aber einen wesentlich geringeren Ökologischen Fußabdruck als Kuwait oder die USA. Wirtschaftswachstum mit hohem Umweltverbrauch ist deswegen keine notwendige Voraussetzung für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und ein gutes Leben.
Zwischen Umweltverbrauch und Einkommensungleicheit ist die Korrelation dagegen hoch. Konkurrenzdenken und Konkurrenzdruck führen zu einer Steigerung des Konsums, um Überlegenheit zu demonstrieren. „Wachstum ist die Ersatzdroge für Einkommensgleichheit. Solange es Wachstum gibt, gibt es auch die Hoffnung, nur das macht große Einkommensunterschiede erträglich“ (Henry Wallich, ehemaliger Chef der US-Bundesbank, zit. n. Wilkinson & Pickett 2010, 253). Der Zusammenhang gilt auch umgekehrt: „Je mehr Einkommensgleichheit, umso weniger brauchen wir die Ersatzdroge. Mehr Gleichheit ist die Voraussetzung für eine Wirtschaft ohne Wachstum“
Einkommensungleichheit erzeugt z.B. den sozialen Druck, sich zu verschulden, um mit anderen mithalten zu können. Robert Frank hat nachgewiesen, dass die Zahl der überschuldeten Familien in den US-Bundesstaaten am höchsten ist, in denen die Einkommensschere am weitesten geöffnet ist.
Auch die Werbebudgets der Wirtschaft variieren mit dem Grad der materiellen Ungleichheit. In Neuseeland und den USA sind sie doppelt so hoch wie in Norwegen und Dänemark (Wilkinson & Pickett 2010, 255).
3. Gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Lösungsansätze
Innerhalb des neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems können weder die o.g. sozialen Probleme noch der Wachstumszwang mit seinen verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt gelöst werden. Dies versuchen die im Folgenden dargestellten Alternativen.
3.1 Das Konvivialistische Manifest
In Japan hat im Jahre 2010 ein Kolloquium mit dem Titel: „De la convialité. Dialogues sur la société conviviale à venir« stattgefunden, das französische Intellektuelle und Wissenschaftler unterschiedlicher weltanschaulicher und politischer Provenienz dazu veranlasst hat, in der Folgezeit ein Manifest zu verfassen, das Antworten auf die zentralen Probleme unserer Zeit: „Grenzen des Wachstums“ und „weltweit dramatisch wachsende soziale Ungleichheit“ liefern soll.
Als Hauptursachen der gegenwärtigen Probleme werden der Primat des utilitaristischen, also eigennutzorientierten Denkens und Handelns und Verabsolutierung des Glaubens an die allein selig machende Wirkung wirtschaftlichen Wachstums gesehen.
Die gegenwärtigen weltpolitischen Entwicklungen enthalten sowohl Bedrohungen als auch Verheißungen. Als Bedrohungen werden gesehen: Klimaveränderung, Wiederkehr der Arbeitslosigkeit, eine maßlos gewordene Kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten, die den Kampf aller gegen alle schürt, immer mehr inner-und zwischenstaatliche Konflikte und Kriege sowie Zunahme mafioser Kriminalität mit Verbindung zu Steuerparadiesen und spekulativer Hochfinanz.
Zu den Verheißungen zählen: Möglicher weltweiter Triumph des demokratischen Prinzips, das durch die arabischen Revolutionen eine Renaissance erfahren hat, ein wirklicher Dialog zwischen den Zivilisationen nach dem Ende des Kolonialzeitalters und des Eurozentrismus sowie die Ausrottung von Hunger und Armut unter der Bedingung einer gerechten Verteilung der vorhandenen materiellen Ressourcen.
Keine der Verheißungen kann in Erfüllung gehen, wenn die Gefahren nicht bewältigt werden. Als größtes Problem sehen die VerfasserInnen Rivalität und Gewalt zwischen den Menschen.
Lösungsbausteine wurden in den letzten Jahrhunderten durch Religionen, Morallehren, politische Doktrinen wie Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus und in den Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelt.
Wichtige konkrete Ansätze sind die Verteidigung der Menschenrechte, der Rechte von Frauen, Arbeitern und Kindern, fairer Handel und vielfältige Formen gegenseitiger Hilfe. Diese Kräfte müssen gebündelt werden zu einer Kunst des Zusammenlebens (lateinisch: con-vivere), „die die Beziehung und Zusammenarbeit würdigt und es ermöglicht, einander zu widersprechen, ohne einander niederzumetzeln und gleichzeitig füreinander und die Natur Sorge zu tragen” (Les Convivialistes 2014, 47).
Dem Wunsch nach Anerkennung aller muss ebenso Rechnung getragen werden wie der Rivalität. Es muss Raum für die Vielfalt der Individuen, Gruppen, Völker, Staaten und Nationen geschaffen werden.
Diesem Ziel dienen die vier Grundprinzipien des Konvivialismus. Dieser versteht sich als neuer Humanismus, der es Menschen ermöglichen soll, sowohl zu rivalisieren als auch zu kooperieren. Erforderlich hierzu ist die Beachtung folgender Prinzipien:
- Prinzip der gemeinsamen Menschheit: Unabhängig von allen Unterschieden gibt es nur eine Menschheit, die in der Person jedes ihrer Mitglieder geachtet werden muss.
- Prinzip der gemeinsamen Sozialität: Der größte Reichtum der Menschheit besteht in ihren sozialen Beziehungen.
- Prinzip der Individuation: Jedem einzelnen wird ermöglicht, seine besondere Individualität zu entwickeln ohne anderen zu schaden.
- Prinzip der Konfliktbeherrschung: Die Individualität bringt es mit sich, dass Menschen gegeneinander opponieren. Dies dürfen sie aber nur solange wie der Rahmen der gemeinsamen Sozialität nicht gefährdet wird (Les Convivialistes 2014, 61 f.).
Als konkrete Sofortmaßnahmen zur Umsetzung empfehlen die VerfasserInnen:
- Schnelle Einführung von Mindest-und Höchsteinkommen, um die schwindelerregende soziale Ungleichheit zu beseitigen
- Erfindung neuer Lebensweisen zum Schutze der Umwelt und der natürlichen Ressourcen
- Pflicht, „die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und in jedem einzelnen eine anerkannte Funktion und Rolle in gemeinschaftsdienlichen Tätigkeiten zu bieten“ (75 f.).
3.2 Care Economy (Sorgearbeit)
Im Unterschied zum traditionellen Begriff der „Reproduktionsarbeit“, der nur unentlohnte Haus- und Sorgearbeit (im Unterschied zu Lohnarbeit) umfasst, lenkt der Begriff der Care-Arbeit den Blick auf die Inhalte konkreter Sorgetätigkeiten und umfasst auch die entlohnten Tätigkeiten von Erziehung, Lehren, Beraten und Pflegen. Auch Selbstsorge und Muße fallen unter diesen Begriff.
Die aus der Überakkumulation von Kapital entstandene Finanz- und Wirtschaftskrise hat zur Senkung der Lohnkosten und der Staatsausgaben geführt, letztere vor allem zu Lasten der Sozialsysteme. „Der Widerspruch zwischen Profitmaximierung und Reproduktion von Arbeitskräften spitzt sich zu. Der Versuch des Kapitals, mit Reallohnsenkungen und Sozialabbau, der Überakkumulationskrise zu begegnen, steht der Reproduktion von einsatzfähigen, breit ausgebildeten Arbeitskräften entgegen“ (Winker 2015, 115).
Da das neoliberale System nicht in der Lage ist, grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, müssen Car-Arbeitende auch nach gesellschaftlichen Alternativen suchen. Hierzu wurde das Konzept der „Care Revolution“ als Transformationsstrategie entwickelt. Ziel der Care Revolution ist eine an menschlichen Bedürfnissen, insbesondere der Sorge füreinander orientierte, radikaldemokratisch gestaltete Gesellschaft. Zentrale menschliche Bedürfnisse, die diese Gesellschaft befriedigen soll, sind nach Max-Neef et al.: „Subsistenz, Schutz, Zuneigung, Verständnis, Partizipation, Muße, Kreativität, Identität und Freiheit“ (zit. n. Winker 2015, 145). Diese Bedürfnisse sind aber historisch veränderlich.
Als wichtigen Schritt zu einer solidarischen Gesellschaft haben Care-AktivistInnen 2014 im Rahmen einer dreitätigen Aktionskonferenz in Berlin das Netzwerk „Care Revolution“ gegründet und sich bisher u.a. an Blockupy-Veranstaltungen beteiligt.
Zentrale Forderungen des Netzwerkes sind:
- Zeitsouveränität (u.a. durch Kürzung der Arbeitszeit) Existenzsicherheit (u.a. bedingungsloses Grundeinkommen)
- Ausbau der sozialen Infrastruktur sowie Demokratisierung und Selbstverwaltung in den Care-Bereichen
- Stopp der Privatisierungen und stattdessen Aufbau selbstverwalteter Projekte.
Wichtig ist auch eine Kultur des Miteinanders und der Solidarität:
„In der heutigen Kultur sind Prinzipien der Über- und Unterordnung entlang von Kategorien wie Geschlecht, sexueller Orientierung, rassistischen Zuschreibungen, Religion, beruflicher Kompetenz und Leistungsfähigkeit fest verankert. Nur indem eine Care Revolution sich gegen damit verbundene Diskriminierungen zur Wehr setzt, aber auch in den eigenen Reihen ihr Verständnis gegenüber den konstruierten anderen reflektiert, ist eine solidarische Gesellschaft überhaupt denkbar“ (Winker 2015, 178).
3.3 Inklusion
Die Diskussion über „Inklusion“ wird seit Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) vor allem für Menschen mit Behinderungen geführt. Sie gilt aber gleichermaßen für Menschen mit Migrationshintergrund oder geringem Einkommen.
Dem Begriff „Inklusion“ wird hier der Vorzug vor dem früher verwendeten Begriff „Integration“ gegeben. Sprachlich bedeutet er „Einschluss“ (nicht Herstellung einer Einheit von zuvor Getrenntem wie bei Integration). Er verlangt die Änderung gesellschaftlicher Strukturen, um allen Menschen einen Platz zu sichern.
Das Beispiel der Schulreife verdeutlicht den Unterschied sehr anschaulich: Während traditionell darunter das individuelle Fähigkeitsprofil eines Kindes verstanden wird, wird unter Inklusionsgesichtspunkten der Blick auf die Schule als Institution gelenkt: ist sie räumlich, organisatorisch und pädagogisch in der Lage, den individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes gerecht zu werden? Die Frage lautet nicht mehr: „Ist dieses Kind reif für die Schule?“ sondern: „Ist diese Schule reif für dieses Kind?“
Inklusion in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen erfordert neben organisatorischen Veränderungen vor allem eine Kultur der Wertschätzung (Anerkennungskultur) gegenüber allen Beteiligten (Schüler, Eltern, Lehrer).
Beispiele hierfür sind der „Index für Inklusion“ und der „Anti-Bias-Approch“. Der von Tony Booth et.al. in England für Kindertageseinrichtungen entwickelte und von der GEW 2006 in deutscher Version herausgegebene Index für Inklusion enthält folgende Dimensionen:
A) Inklusive Kulturen entfalten,
B) Inklusive Leitlinien etablieren und
C) Inklusive Praxis entwickeln.
Der Dimension „Inklusive Kulturen entwickeln“ werden u.a. folgende Indikatoren zugeordnet:
- „Jeder soll sich willkommen fühlen.Die Kinder helfen sich gegenseitig.
- Die Erzieherinnen arbeiten gut zusammen.
- Die Mitarbeiter/innen und die Kinder begegnen sich mit Respekt.
- Es gibt eine Partnerschaft zwischen Mitarbeiter/innen und Eltern.“ (Booth et al. 2006, 72)
Das internationale Netzwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) hat wesentliche Anregungen von dem in den USA von Louise Derman-Sparks entwickelten Anti-Bias-Approach (zu Deutsch: vorurteilsbewusste Erziehung) zur Entwicklung einer inklusiven Kultur erhalten und u.a. folgende Prinzipien entwickelt:
- „Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen jede Person darin, Stolz auf die eigene vielschichtige Identität zu entwickeln, indem sie die individuelle und die verschiedenen Berufsgruppenidentitäten wahrnehmen und anerkennen.
- Sie schaffen eine sichere Atmosphäre, in der alle – auch gegensätzliche – Werte und Vorstellungen zum Ausdruck gebracht und diskutiert werden können.
- Die Bedürfnisse, Interessen, Fragen der Kinder, ihre Erfahrungen und wie sie diese Erfahrungen eigensinnig deuten und verarbeiten, stehen im Fokus der pädagogischen Aktivitäten.
- Kinder, Eltern und Pädagogen tauschen sich aus, um mehr voneinander und den jeweiligen Lebenssituationen zu erfahren und zu verstehen und um angemessen aufeinander zugehen zu können“ (Schallenberg-Diekmann 2013, 269).
Diese Beispiele veranschaulichen sehr gut, wie eine Anerkennungskultur aussehen kann, die allen Menschen die von den Konvivialisten geforderte anerkannte Funktion und Rolle in gemeinschaftsdienlichen Tätigkeiten sichert. Ihre Übertragung auf andere gesellschaftliche Bereiche ist dringend erforderlich, wenn menschliche Bedürfnisse ohne umweltschädlichen Wachstumszwang befriedigt werden sollen.
3.4 Gemeinwohl-Ökonomie
Die von Christian Felber (o.J.) entwickelte Gemeinwohlökonomie ist gut geeignet, sie bisher dargestellten sozialen und kulturellen Alternativen in ein ökonomisches System zu integrieren. Sie beruht auf denselben Grundwerten, die unsere Beziehungen gelingen lassen: Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen. Wirtschaftlicher Erfolg wird nicht in Geld, Kapital und Finanzgewinn gemessen, sondern in Bedürfnisbefriedigung, Lebensqualität und Gemeinwohl.
Unternehmen können ihre optimale Größe selbst bestimmen, da Gewinn kein Ziel, sondern nur noch Mittel ist. Sie müssen keine Angst mehr davor haben, von anderen gefressen zu werden, wenn sie nicht wachsen und stärker und profitabler sind als andere. Statt Konkurrenz wird Kooperation angestrebt, um im Sinne einer solidarischen Lerngemeinschaft Erfahrungen auszutauschen.
Wirtschaftswachstum ist kein Ziel mehr. Stattdessen wird die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks zum kategorischen Imperativ und die Erwerbsarbeitszeit wird schrittweise so reduziert, dass genügend Zeit für Beziehungs- und Betreuungsarbeit, Eigenarbeit sowie politische und Gemeinwesenarbeit bleibt.
4. Diskussion im Rahmen der Sommerakademie 2015
Die WorkshopteilnehmerInnen haben zunächst Ergänzungen zu den vorgestellten Ansätzen einer solidarischen Gesellschaft vorgenommen:
Die Schenk(er)-Bewegung (Geben ohne Bedingung einer Gegenleistung) ist eine Bewegung, die für ganzheitliche Nachhaltigkeit, globale Verantwortung und globale Liebe steht.
Der Beutelsbacher Konsens über die theoretischen Grundlagen der politischen Bildung von 1976 enthält drei Elemente: Überwältigungsverbot (keine Indoktrination), Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik im Unterricht und Befähigung der Schüler, ihre eigenen Interessen zu analysieren.
Die von Lawrence Kohlberg entworfene Theorie der Moralentwicklung enthält auf der letzten – postkonventionellen – Ebene die Orientierung am Prinzip der zwischenmenschlichen Achtung und dem Vernunftstandpunkt der Moral. Konflikte sollen unter Einbeziehung aller Beteiligten gelöst werden.
Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass sie eine Emanzipation vom gegenwärtigen Gesellschafts- und Arbeitssystem (Druck, Hierarchie) erstreben und nach innerer Erfülltheit sowie mehr Kommunikation zwischen den Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen suchen.
Ursachen dafür, dass es trotz breiter Zustimmung zu diesen Zielen noch nicht gelungen ist, sie durchzusetzen, werden u.a. darin gesehen, dass zu viele kleine Organisationen nebeneinander arbeiten. Eine Transformationsstrategie könnte darin bestehen, diese Organisationen zusammenzuführen, damit eine kritische Masse überschritten wird und das Thema mehr öffentliche Resonanz z.B. in Talkshows findet. Als Ansatzpunkt wurde die Klimaveränderung gesehen, die irreparable Schäden hervorruft und dadurch zu einer Umkehr zwingt.
5. Literatur
Beutelsbacher Konsens www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
Booth, Tony, Mel Ainscow & Denise Kingston (2006): Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln. Herausgeber: GEW, Frankfurt a.M.
Felber, Christian (o.J.): Die Gemeinwohl-Ökonomie. Eine demokratische Alternative wächst. www.christian-felber.at/schaetze/gemeinwohl.pdf (15. 8. 2015)
Les Convivialistes (2014): Das konvivialistische Manifest. Für eine neue Kunst des Zusammenlebens. Herausgegeben von Frank Adloff und Klaus Leggewie in Zusammenarbeit mit dem Käte Hamburger Kolleg / Center for Global Cooperation Research Duisburg, September 2014
Schallenberg-Diekmann, Regine (2013): Internationale Zusammenarbeit für Vielfalt und Gleichwürdigkeit. In: Wagner, Petra (Hrsg.): Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung, Herder Verlag, Freiburg i.Br., 260-278
Schenk(er)-Bewegung www.global-love.eu
Schuhler, Conrad (2015): Ist Umverteilen im Kapitalismus möglich? Isw-Newsletter, München, 18. 2. 2015
Wilkinson, Richard und Kate Pickett (2010): Gleichheit ist Glück. Warum gerechtere Gesellschaften für alle besser sind. Tolkemitt Verlag, Berlin
Winker, Gabriele (2015): Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft. transcript Verlag, Bielefeld
Download als PDF