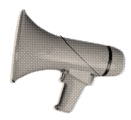Die Marke „Soziale Marktwirtschaft“ – Wie ein Begriff gesetzt wurde
Es war schon etwas irritierend, als sich Sahra Wagenknecht in ihrem Buch „Freiheit statt Kapitalismus“ zur „Sozialen Marktwirtschaft“ bekannte und sich damit vermeintlich auf den Ordoliberalen und ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft, Ludwig Erhard, berief, mit dessen Namen diese untrennbar verbunden scheint. Gilt Erhard doch in der bundesdeutschen Geschichtsschreibung als Erfinder der „Sozialen Marktwirtschaft“. Dass Letzteres eigentlich ein Missverständnis ist, macht eine aktuelle Publikation des Historikers Uwe Fuhrman deutlich. Darin beschreibt er die Entstehungsgeschichte der „Leeren Signifikanten »Soziale Marktwirtschaft«“ und zeichnet dazu die Wirtschafts- und Sozialpolitik um die Zeit der Währungsreform im Sommer 1948 nach.
Fragestellung und Methode
Nach einer kurzer Einleitung legt Fuhrmann im Kapitel 2 seine Fragestellung und seine Untersuchungsmethode dar. Er geht der Frage nach, wie der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ entstand und wirkungsmächtig werden konnte. Dabei interessieren ihn sowohl die gesellschaftlichen Umständen als auch die Beteiligten. Fuhrmann erläutert ausführlich seinen Werkzeugkasten und die Methode der von ihm verwendeten „historischen Dispositivanalyse“. Diese ist eng mit dem „(post-)strukturalistischen Diskurskonzept“ verbunden (13). Unter Dispositiv wird in diesem Kontext die „Gesamtheit verschiedener Elemente“ verstanden, „die einem bestimmten Themenbereich zugeordnet werden“ und netzartig verbunden sind. Hierzu zählen „Aussagen, Diskurse, Lehrsätze, Architekturen, Praxen oder Gesetze“. Fuhrmann hält die Dispositivanalyse für seine Fragestellung gut geeignet, weil mit ihr die „wirklichkeitskonstituierende Funktion von Sprache“ ebenso wie die Sozialgeschichte in die Untersuchung einbezogen werden kann. Die Methode könne dabei helfen, „sowohl Strukturen, als auch Akteure (und dazwischen Handlungen) gleichermaßen zu berücksichtigen“ (14). Es geht ihm also darum, „das Verhältnis zwischen Subjekt und Diskurs bzw. zwischen Akteur und Struktur“ als eines der zentralen Spannungsfelder für die historische Analyse zu erfassen. Dabei gehe es ihm auch um ein besonderes Verständnis von Machtverhältnissen. Macht werde nicht von oben unilateral ausgeübt, sondern sei als „Verhältnis zwischen Akteuren“ zu betrachtet, als „soziale Beziehung“. „Individuen haben – abhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung – zwar Einfluss auf Machtverhältnisse, aber kein Kommando.“ (15) Die Dispositionsanalyse sei besonders hilfreich, da sie das „Wechselverhältnis zwischen Diskursen und nichtdiskursiven Praxen“ untersuche (18).
Die Dispositivanalyse geht auf Foucault zurück. Dispositive sind immer auch Antworten auf einen „Notstand“. Foucault benutzt den Begriff des Dispositiv sowohl für ein Vorhaben (Was planen Akteure?) als auch für eine Ergebnis (Was kommt am Ende einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung heraus?). Um beides besser zu unterscheiden, bezeichnet Fuhrmann ein Dispositiv als Vorhaben als „Strategisches Dispositiv“ und ein Dispositiv als Ergebnis als „Modifiziertes Dispositiv“ (21).
In der Diskursanalyse wird Sprache als wirklichkeitskonstruierend verstanden, ist also selbst Praxis, welche die Gegenstände bildet, über die sie spricht (28f.). In diesem Kontext ist eine Äußerung zu einem bestimmten Sachverhalt ein Einzelfall, durch den durch Wiederholung eine Aussage werden kann. Wird diese Aussage in ähnlichem Zusammenhang wiederholt, entsteht eine gewisse Ordnung. Von einem Diskurs kann gesprochen werden, wenn aus Äußerungen Aussagen wurden und diese eine gewisse Reichweite und prominente Fürsprecher haben (30f.). Im Diskurs kann ein „Leerer Signifikant“ entstehen, der auf etwas „Unmögliches“ verweist, „nämlich auf das »Allgemeine«, im Falle des »Sozialen Marktwirtschaft« auf die »gesellschaftliche Vollkommenheit«, also auf einen Idealzustand von »Allgemeinwohl«.“ Es sei gelungen, in der Bundesrepublik den Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ als Leeren Signifikanten im Bereich des ordnungs-, wirtschafts- und sozialpolitischen Diskurses zu etablieren. Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ steht heute gleichsam für ein perfektes Wirtschaftssystem (33).
In Kapitel 3 begründet der Autor umfangreich die Auswahl des Untersuchungszeitraums und stellt anschließend den Aufbau seiner Arbeit dar: Kapitel 4 beschreibt die wirtschaftliche Situation in der Nachkriegszeit, die wichtigsten Akteure mit deren Interessen sowie die wesentlichen Institutionen. Kapitel 5 geht auf die „Notstandssituation“ ein, also den gesellschaftlich kritischen Zeitraum von 1945 bis zur Währungsreform im August 1949. Darauf aufbauend folgt in Kapitel 6 die Darlegung des strategischen Dispositivs „Freie Marktwirtschaft“, mit dem der damalige Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Ludwig Erhard seine Wirtschaftspolitik durchsetzen wollte. Dies gelang ihm allerdings nicht, weil auf die Währungsreform extreme Preissteigerungen folgten, auf die vor allem die Gewerkschaften mit massiven Protesten regierten. Dieser „Widerstand“ wird in Kapitel 7 beschrieben. Als eine Reaktion auf die Proteste wurde das strategische Dispositiv von der „Freien Marktwirtschaft“ zur „Soziale Marktwirtschaft“ modifiziert. Dieser Prozess wird im Kapitel 8 beschrieben, bevor im Kapitel 9 das Fazit gezogen und die Arbeit mit einem Epilog zur Historisierung der „Sozialen Marktwirtschaft“ abgeschlossen wird.
Notstandssituation nach 1945
Nach 1945 herrschte in Deutschland zwar ein großer Mangel an Lebensmitteln und Wohnungen, der Bestand an Produktionsmitteln lag allerdings 11 Prozent über dem von 1936 (57). Zudem war eine hohe Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte verfügbar (58). Es herrschten also gute Voraussetzungen für eine prosperierende Wirtschaft. Ab dem Frühjahr 1948 wurde die Integration der drei Westzonen unter Inkaufnahme der Teilung Deutschlands massiv betrieben (60) und die Bizone, der im Januar 1947 erfolgte Zusammenschluss der Besatzungszonen, sowie der dort installierte Wirtschaftsrat können als Vorläufer deutscher parlamentarischer Strukturen verstanden werden. Ab Februar 1948 existiere in diesem Wirtschaftsrat eine koalitionsähnliche Zusammenarbeit von CDU/CSU, FDP und kleinen bürgerlichen Parteien (DP, Zentrum und Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung) (64). Die 1948 neu gegründeten Gewerkschaften erlebten einen starken Zulauf und verfügten schnell über 4,6 Millionen Mitglieder. 45 Prozent der Beschäftigten in der Britischen Zone und 37 Prozent in der Amerikanischen Zone (67) traten damals einer Gewerkschaft bei. Der zentrale Streitpunkt innerhalb der Gesellschaft war zu dieser Zeit „die Frage nach der zukünftigen Wirtschaftsordnung, weil als Verarbeitung der historischen Erfahrungen die meisten Akteure den Kapitalismus auf die eine oder andere Art überwinden wollten. Der Konflikt um die Wirtschaftsverfassung manifestierte sich in den Kämpfen um den Grad der Mitbestimmung im Betrieb und auf gesellschaftlicher Ebene.“ (79) Zwar herrschte in den Jahren 1946/47 eine „antikapitalistische Grundstimmung“ von den Arbeiterparteien über die Gewerkschaften bis in bürgerliche Kreise, jedoch existierte „kein gemeinsamer Gegenentwurf, keine gegenhegemoniale Erzählung, kein griffiger und konsensfähiger Leerer Signifikant, der die mitunter großen Differenzen hätte zumindest teilweise überbrücken können.“ (85)
Im Winter 1946/47 brach die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zusammen (80). Die Zuweisung von Lebensmitteln erfolgte zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen über Lebensmittelgutscheinen zu festgesetzten Preisen, daneben existierte ein nicht unerheblicher Schwarzmarkt (82). Zu Beginn des Jahres 1948 entwickelte sich eine massive Protestwelle, welche Demonstrationen und unter anderem21 lokale Generalstreiks zur Folge hatte (106) „Die materiellen wie geistigen Folgen des Krieges stellten in den ersten Nachkriegsjahren einen dramatischen Notstand dar, der sich durch die zunehmend schwieriger werdende Versorgung der Bevölkerung noch verschlimmerte.“ (116) Trotz dieses Notstands gab es bis ins Jahr 1948 hinein keinen einflussreichen gesellschaftlichen Akteur mit einem strategischen Dispositiv. Die Akteure, die eine demokratische Kontrolle über die Wirtschaft verhindern wollten (darunter beispielsweise die US-amerikanischen Besatzungsbehörden) waren erfolgreich, (117) während die Gewerkschaften in einer auf Verhandlung und Kooperation orientierten Politik verharrten. „Ein Versuch, während der historischen Ausnahmesituation bei Mitbestimmung und Sozialisierung Regelungen zu erreichen, die auch von eine Adenauer-Regierung schwer wieder rückgängig gemacht werden können, wurde nicht gemacht.“ (118) Dagegen hatte sich die „informelle Allianz derjenigen, die sich für eine ‚freie Marktwirtschaft’ einsetzen und politische Alternativen bekämpften, (…) schon Monate vor der Währungsunion formiert.“ (121) Ludwig Erhard war ein wichtiger Akteur in dieser Allianz, ebenso die westlichen Alliierten. Im März 1948 wurde Erhard auf Vorschlag der wirtschaftsliberalen Kräfte in der FDP gegen Widerstände in der CDU zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft ernannt. Bereits vorher hatte er immer wieder deutlich gemacht, für welche Wirtschaftspolitik er stand: Für eine „Freie Marktwirtschaft“ ohne Preisbindung (124). Bis zur Währungsreform am 20. Juni 1948 waren Güter und Lebensmittel von den Behörden bewirtschaftet worden. Die Zuteilung an Endverbraucher*innen erfolgte durch Lebensmittelmarken, daneben galten eine umfangreiche Preisbindung und ein Lohnstopp, wobei die Produktionsmittel und damit Beschaffung, Produktion und Absatz in privater Hand verblieben (130). Die Folgen waren ein florierender Schwarzmarkt und eine Disparität zwischen Geldmenge und Produkten. Es wird geschätzt, dass die Hälfte der Produktion direkt in den Schwarzmarkt floss (130f.). Unternehmen hatten kein Interesse, ihre Produkte zu gedeckelten Preisen in den regulierten Markt zu geben und dafür Reichsmark zu erhalten – eine Währung, die insgesamt überbewertet war. Die Situation hatte sich bis 1948 immer weiter zugespitzt, da alle auf die Währungsreform warteten und Unternehmen und Handel zunehmend Waren horteten. Mit der Währungsreform wurden die Preise freigegeben, während der Lohnstopp fortdauerte. Die Währungsreform benachteiligte vor allem Lohnempfänger, da die Freigabe der Preise bei gleichzeitiger Fortgeltung des Lohnstopps dazu führte, dass der Lohn für weniger Lebensmittel reichte als zuvor. Mit der Währungsreform sollte eine „Freie Marktwirtschaft“ eingeführt werden. Flankiert wurde diese durch das „Leitsätzegesetz“, das für rund 400 Warengruppen die Preise freigab und für andere Waren weiter festschrieb. Die politischen Träger des Konzeptes im Wirtschaftsrat waren CDU, CSU, DP und FDP, der Länderrat gab mit den Stimmen der SPD sein Einverständnis dazu. In der Öffentlichkeit war Ludwig Erhard das Gesicht der marktwirtschaftlichen Wende (161). In den sechs Monaten zwischen der Währungsreform und dem Jahresende 1948 entwickelte sich eine enorme Protestwelle in der Bizone(165). Fuhrmann sieht dafür fünf Gründe: die massiven Preissteigerungen für Güter des täglichen Bedarfs, den weiterhin geltenden Lohnstopp, die politische Opposition gegen eine „Freien Marktwirtschaft“, die Wut über soziale Ungerechtigkeit und die Missachtung von Demokratie und Rechtssicherheit durch die Behörden (167). Kaum war die Währungsreform in Kraft getreten, kam es zu ersten Ausschreitung auf Samstagsmärkten: Marktstände wurden umgeworfen, Waren ohne Bezahlung angeeignet und Zwang auf Händler*innen ausgeübt, die Preise zu senken (173). Gewerkschaften und Belegschaften von Betrieben führten selbstständig Preiskontrollen durch (176) und in einigen Städten wurde zu Kaufstreiks aufgerufen (178ff.). Ab August 1948 folgten Streiks und überörtliche Demonstrationen (180). Bei den Aktionen wurden Rücktrittsforderungen an Erhard (189) geäußert und die Rückkehr zur Bewirtschaftung der lebensnotwendigen Güter gefordert (189). Im Herbst organisierten die Gewerkschaften in Stuttgart eine Kundgebung mit 80.000 Teilnehmenden. Dort wurde Forderungen nach einer gut geplanten Ökonomie mit staatlich kontrollierten Preisen sowie einer kompletten Reform des Wirtschaftssystem erhoben (200f.). Im Anschluss an die Versammlung kam es zu Ausschreitungen mit bis zu 2.000 Beteiligten (204). Im November folgte ein 24-stündiger Generalstreik in der Bizone mit insgesamt viereinhalb Millionen Beteiligten bei insgesamt 12 Millionen Beschäftigten (214). Gefordert wurden Maßnahmen gegen Wucher und Preissteigerungen sowie die planwirtschaftliche und wirtschaftsdemokratische Umgestaltung der westdeutschen Wirtschaft (216). In Reaktion auf die Proteste wurde der Lohnstopp aufgehoben. Damit wurde eine der Forderungen der Gewerkschaften erfüllt und diese verlagerten ihre Aktivitäten wieder stärker auf die betriebliche und tarifliche Ebene (228).
Von der „Freien“ zu „Sozialen Marktwirtschaft“
Weitere Reaktionen auf Proteste waren staatliche Maßnahmen zur Preisregulierung (beispielsweise ein Gesetz gegen Preistreiberei) sowie staatliche Produktionsprogramme (233ff.). Hervorzuheben ist das „Jedermann-Programm“: Mit diesem Programm wies der Staat Rohstoffe an Firmen zu und gab Qualität und Preise der Endprodukte vor (244ff.). Mit diesen lenkenden Maßnahmen wurde die Fixierung auf einen freien und möglichst wenig regulierten Markt aufgeweicht. Das Jedermann-Programm war eine eindeutige „Modifizierung des Dispositivs“ der „Freie Marktwirtschaft“ und erst mit ihr setzte sich allmählich auch die Bezeichnung dieses wirtschaftspolitischen Kurses als „Soziale Marktwirtschaft“ durch. Diese begriffliche Wende erfolgte jedoch „erst nach dem Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik“ der sich beispielweise im Jedermann-Programm zeigte (246). Der Diskurs verschob sich von einer „Freien Marktwirtschaft“, die angesichts der Preissteigerungen, der Proteste und der Wirtschaftsregulierung nicht mehr zu halten war, hin zu einer „Sozialen Marktwirtschaft“. Bis weit in das Jahr 1948 hinein war der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ jedoch allenfalls Spezialisten bekannt (261). Von Erhard selbst wurde er zum ersten Mal am 17. August 1948 spontan in einer Rede benutzt (264f.). Ab diesem Zeitpunkt betont Erhard zwar zunehmend das Soziale an seiner Politik: „Ich nehme für mich in Anspruch, nichts anderes zu wollen und nichts zu erstreben, als durch eine soziale Marktwirtschaft ein Maximum an Lebensmöglichkeiten und ein Maximum an Lebenssicherung für unsere Volk sicherzustellen.“ (269f.) Allerdings erfolgt für Fuhrmann die „eigentliche diskursive Inauguration der »sozialen Marktwirtschaft«“ erst rund um den Generalstreik am 12. November 1948. Unter der Fahne der „Sozialen Marktwirtschaft“ forderten damals Erik Nölting (SPD), der DGB als Organisation, Albin Karl (DGB/SPD), die CDU-Sozialausschüsse und schließlich der katholische Ökonom Oswald Nell-Breuning „politische Kurskorrekturen“ (281). Der Chef des Wirtschaftsrates der Bizone Hermann Pünder äußert sich in der „Regierungserklärung“ zum Generalstreik zum ersten Mal systematisch und bewusst unter Benennung von Maßnahmen (darunter auch das Jedermann-Programm) zu einer „Sozialen Marktwirtschaft“ (288). Durch ihn „wurde zur Aussage, was am 17. August 1948 erstmals als Äußerung hervorgetreten war: Die »Sozialen Marktwirtschaft« sei das allgemeine Ziel, dessen Erreichung das höchste Allgemeinwohl zur Folge hätte“ (291). Damit etablierte Pünder die „Soziale Marktwirtschaft“ als „Leere Signifikante“ (289). „Soziale Marktwirtschaft“ stand ab diesem Moment für eine Wirtschaftsordnung, die nicht näher definiert, aber überwiegend positiv besetzt war und Wohlstand für alle versprach. Sie grenzte sich dabei sowohl gegen eine Planwirtschaft, als auch gegen eine ungeregelte Marktwirtschaft ab. Die treibende Kraft bei der Durchsetzung des Begriffs war allerdings nicht Erhard, „sondern seine Kritiker oder zumindest ein bestimmter Teil von ihnen“ (291). Im Januar 1949 bekannte sich schließlich die CDU in ihrem Wahlprogramm zum ersten Mal zur „Sozialen Marktwirtschaft“ (299). Erhard scheint erst im Februar 1949 aufgrund der Kräfteverhältnisse endgültig auf diesen Begriff gesetzt zu haben. Wobei er damit nicht die Begriffsbedeutung seiner Gegner übernahm: Während diese unter „Sozialer Marktwirtschaft“ eine „spezifische Form von Regulierung des Wettbewerbs verstanden, sah Erhard in der Wortkombination seine Überzeugung ausgedrückt, der Wettbewerb an sich sei sozial.“ (300)
Fazit
Fuhrmann arbeitet in seiner Untersuchung heraus, dass die Antagonisten Erhards eine wesentliche Rolle bei der Durchsetzung des Begriffs der „Sozialen Marktwirtschaft“ gespielt haben, während dieser sich lange geweigert hatte, den Begriff zu benutzen. Übertragen auf andere gesellschaftliche Situationen bedeutet dies, dass auch kritisch gedachte Beiträge dabei helfen können, einen Diskurs hegemonial werden zu lassen. Fuhrmann zeigt anhand des Beispiels eindrucksvoll, dass sprachliche Interventionen im Zweifel alleine nicht ausreichen, um die Modifikation von Begriffen und Bedeutungen zu bewerkstelligen. Konkrete Handlungen wie Streiks und Demonstration sind ebenso notwendig wie staatliche Maßnahmen wie das Jedermann-Programm, das bei der Etablierung des Begriffs der „Sozialen Marktwirtschaft“ eine bedeutende Rolle spielte.
Uwe Fuhrmann: Die Entstehung der »Sozialen Marktwirtschaft« 1948/49, Eine historische Dispositivanalyse, UVK Verlagsgesellschaft mbH
Download als PDF