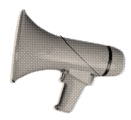Das Sklavenschiff. Eine Menschheitsgeschichte
Das Wichtigste vorab: Ja, es gelingt Marcus Rediker, mit dem Sklavenschiff die Geschichte der
Menschheit (wie die Übersetzerin Sabine Bartel das nicht so eindeutige englische Original „The
Slave Ship: A Human History“ richtig fasst) im Kapitalismus zu schreiben. Nicht nur symbolisch,
sondern ganz real ist in der modernen Welt kaum etwas zu verstehen ohne das Sklavenschiff. Es
gibt im Buch einige Passagen, in denen dieser Befund verdichtet dargestellt wird, ich zitiere eine
etwas ausführlicher:
„Der ursprüngliche primäre Widerspruch auf dem Schiff, der Widerspruch zwischen Kapitän und
Besatzung, wurde an der Küste Afrikas und auf der Middle Passage (alle Kursivschreibungen im
Original – WR) sekundär. Und obwohl die Seeleute nun den 'Lohn der Weißheit' zu ernten
begannen, klagten sie über ihre neue Situation. Sie beschwerten sich bitter – und, wie betont werden
muss, eigennützig und unaufrichtig – , dass die Versklavten auf dem Schiff besser behandelt würden
als sie selbst. Sie beschwerten sich über ihre Unterbringung: Wenn die afrikanischen Sklaven an
Bord kämen, blieben für sie selbst keine Schlafplätze mehr. Sie beschwerten sich über ihre
Gesundheitsversorgung: ... Am laustarkesten beschwerten sie sich über das Essen: ... Die
sogenannte freien Arbeiter würden schlechter behandelt als die Versklavten, an denen sowohl der
Kaufmann als auch der Kapitän ein ungleich größeres Interesse hätten, weil sie wertvolles Eigentum
darstellten.“ (S. 340)
Wer hört sie hier nicht reden, die modernen Rassisten, die angeblich gar keine sind, sondern nur
„mit der großen Zahl der Migrant*innen in ihren Kommunen überfordert“ sind? Und wer erkennt
hier nicht die „materialistischen“ Analysen angeblicher Linker, die in Wirklichkeit gar keine sind,
dass Migrant*innen und Kapitalist*innen gemeinsame Sache machten, um das Leben hiesiger
Arbeiter*innen kontinuierlich unerträglicher zu gestalten, die einen um des Profits, die anderen um
billiger Vorteile wegen?
Und in der Tat, auch „die Seeleute fanden heraus, dass das 'Privileg der weißen Haut', so bescheiden
es auch sein mochte, rückgängig gemacht werden konnte – selbst auf der Middle Passage, gegen
deren Ende sie zu entbehrlichen, überschüssigen Arbeitskräften wurden. Die Matrosen wurden
misshandelt, von Bord geworfen und sich selbst überlassen. Die volle Härte des Klassensystems
war wieder hergestellt. Der Matrose war eine dritte Größe zwischen zwei viel größeren und
gewichtigeren 'Tänzern': dem Kaufmann, seinem Kapital und seiner Klasse auf der einen Seite und
der afrikanischen Gefangenen, ihrer Arbeitskraft und ihrer im Entstehen begriffenen Klasse auf der
anderen. In seinem Kampf darum, sich diese Zwischenposition zu erhalten und seiner eigenen
Ausbeutung in einem gefährlichen Gewerbe Grenzen zu setzen, widersetzte sich der Matrose
Lohnkürzungen – wie 1775 in Liverpool – , aber er streikte nicht gegen den Sklavenhandel. Er
streikte für bessere Löhne innerhalb des Sklavenhandels.“ (S. 340f)
Genau so wenig, wie der Matrose die Aufstände der Sklaven unterstützte, solidarisiert sich der
weiße hiesige Arbeiter mit der Migrantin – meistens zumindest. Das stellt ihn aber gegenüber dem
Kapitalisten, egal woher der kommen mag, in keinem Fall besser.
Wenn wir auf die formale Seite des Buches schauen, dann hat Rediker in zehn Kapiteln, einer
Einführung und einem Epilog die verschiedenen Aspekte des transatlantischen Sklavenhandels
Stück für Stück und unter einem je spezifischen Aspekt untersucht und dargestellt. Er hat dabei
umfassend Quellen ausgewertet, die zum Teil nur kleinste Bruchstücke des Themas erhellen,
manchmal aber auch schon von anderen erstellte umfassende Stoffsammlungen sind. Eine
Rezension ist hoffnungslos damit überfordert, auch nur einigermaßen die wichtigsten Inhalte
darzustellen. Ich werde mich deshalb darauf beschränken, die jeweiligen thematischen
Schwerpunkte der Kapitel zu benennen und einen Einzelaspekt kurz anzureißen. Die immer wieder
beispielhaft geschilderten individuellen Schicksale und Erfahrungen fallen dabei leider auch unter
den Tisch, obwohl sie oft für das Verstehen so aufschlussreich sind wie die historischen und
fachlichen Darstellungen.
Die Einführung gibt eine Vorstellung von der Dimension des transatlantischen Sklavenhandels (12,4
Millionen Menschen aus Afrika, von denen 10,6 Millionen in den Amerikas ankamen), der Situation
der Seeleute (deren Sterberate genau so hoch war wie die der Versklavten), den Konflikten unter der
Gefangenen und den gesellschaftlichen Debatten in Nordamerika und Großbritannien. Nur deren
Schiffe und das nur zwischen 1700 und dem Verbot des Handels 1808 sind Gegenstand der
Untersuchung. Auch auf die Rolle des Schiffs selbst und die sehr geringe Aufmerksamkeit, die es
bis dahin in der Forschung erfahren hat, wird eingegangen. Dabei muss erwähnt werden, dass das
Buch in den USA schon 2007 erschienen ist und leider erst jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt.
Das erste Kapitel handelt von „Leben, Tod und Terror im Sklavenhandel“ und stellt eine typische
Auswahl Beteiligter vor: Seeleute, Sklavinnen, Schiffsjungen, Sklavenhändler, Piraten und vor
allem Kapitäne und Kaufleute. Einer weiterer, der kaum irgendwo vorkommt und doch eine ganz
entscheidende Rolle spielt, könnte überraschen: Haie waren immer um die Sklavenschiffe herum;
sie verhinderten die Flucht der Gefangenen, ermöglichten ihnen aber den Selbstmord, sie
erschwerten die Desertion der Seeleute und vollstreckten gelegentlich eine Hinrichtung.
Die „Entwicklung des Sklavenschiffs“ ist identisch mit der Entstehung des Kapitalismus, der ohne
den Kolonialismus vermutlich lange Zeit eine Episode in einem Zipfel des eurasischen Kontinents
geblieben wäre. Neben der gusseisernen Kanone war es „das hochseetaugliche, segelbestückte
nordeuropäische Rundschiff“, das „es den herrschenden Klassen der westeuropäischen Staaten
zwischen 1400 und 1700 möglich machte, die Welt zu erobern“ (S. 68). Dabei unterschied sich das
Sklavenschiff in seinem Kern als gigantische Maschine nicht von anderen Hochseeseglern, hatte
allerdings einige zusätzliche Vorrichtungen, die der Verstauung der Gefangenen und ihrer Kontrolle
dienten. Die politische Ökonomie des Sklavenschiffs war allerdings eine andere als die anderer
Handelsschiffe: „Der Handel mit Versklavten war so kostspielig und erforderte eine derartige
Konzentration an Ressourcen, dass privates Kapital allein anfangs nicht ausreichte, ihn zu
finanzieren. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts setzten sich schließlich die sogenannten Freihändler
gegen die regulierten Monopole durch, allerdings erst, nachdem der Staat sich am Aufbau der
Infrastruktur für den Handel beteiligt hatte.“ (S. 75) Das wird sich im Laufe der kapitalistischen
Entwicklung nicht mehr ändern, in der Regel sind es zunächst staatliche Gelder, die Innovationen
auf den Weg bringen, die dann anschließend private Profite generieren.
Im Dritten Kapitel geht es darum, wie die Menschen vom afrikanischen Festland zum Sklavenschiff
kommen. Der Sklavenhandel als solcher hat auf dem afrikanischen Kontinent eine lange Tradition
und hat in einigen Gegenden die Ökonomie geprägt. Mehr als 9 Millionen Menschen wurden seit
dem 7. Jahrhundert alleine auf der Sahararoute nach Norden geschafft und dort verkauft. Auf der
Atlantikroute kamen die Sklaven bis zur oben erwähnten Etablierung privater Kaufleute
überwiegend aus Küstennähe. Das änderte sich ungefähr zur Zeit, als unser Buch einsetzt. Das
Kapitel beschreibt die Entwicklung in den sechs Haupthandelsgebieten Sengambia, Sierra Leone
und Windwardküste, Goldküste, Bucht von Benin, Bucht von Biafra und westliches Zentralafrika
um dann nach dem Sozialporträt der Gefangenen zu fragen. In der Regel waren sie
Kriegsgefangene, wobei die Definition von „Krieg“ immer weiter ausgedehnt wurde, sodass bald
alle Formen von bewusster Gewaltanwendung zum Zweck der Gefangennahme als „Krieg“
bezeichnet wurden. Üblich wurde auch die Praxis, wegen Verbrechen, später auch wegen kleinerer
Vergehen Verurteile zu versklaven und nach und nach verlegten sich tief im Landesinneren Gruppen
auf die Menschenjagd, die dann (oft von anderen, darauf spezialisierten Gruppen) in langen
Märschen zur Küste gebracht wurden. Auch hier sehen wir, wie eine damals entstandene Struktur
überlebt hat: „Als Ergebnis dieses Prozesses der Auslese, Versklavung und Verschiffung entstand
eine tiefe, dauerhafte Kluft zwischen den 'gewöhnlichen' Afrikaner*innen und ihren herrschenden
Eliten.“ (S. 142)
Der zu seiner Zeit als Gustavus Vassa bekannte Mann, der in Wirklichkeit Olaudah Equiano hieß,
war als Elfjähriger im heutigen Nigeria von afrikanischen Händlern auf das Sklavenschiff gebracht
worden, das ihm so rätzelhaft und unheimlich vorkam wie die „weißen Männer“. Was er schnell
verstand, war, dass sie keine menschlichen Wesen sein konnten, sondern böse Geister sein mussten
und das Schiff ein Ort des Schreckens. Dennoch versuchte er, weil die Jungen sich relativ frei auf
dem Schiff bewegen konnten, möglichst viel über dessen Funktionsweise zu lernen, was es ihm
ermöglichte, als (versklavter) Seemann zu arbeiten und sich im Alter von 24 Jahren mit der
ersparten Heuer freizukaufen. Es gibt allerdings eine Kontroverse darüber, ob seine Geburts- und
Versklavungsgeschichte stimmt. Sicher ist, dass er mit „The Interesting Narrative of the Life of
Eloudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African“ eines der wichtigsten Werke der
abolitionistischen Bewegung schrieb. Einige glauben, er sei schon als Sklave in South Carolina
geboren worden und hätte alles über Gefangennahme, Schiff und Überfahrt nur vom Hörensagen.
Aber „wenn er in South Carolina geboren wurde, muss er alles, was er wusste, in Erfahrung
gebracht haben, indem er die Überlieferungen und Erfahrungen von Menschen zusammentrug, die
in Afrika geboren worden waren und die gefürchtete Middle Passage auf dem Sklavenschiff
durchlebt hatten. Dies würde ihn zu einem Historiker mündlicher Überlieferung machen, einem
Bewahrer gemeinsamer Geschichte.“ (S. 159) Auch wenn die meisten nicht so viel Beachtung
finden wie Equianos, die „Stimmen der Stimmlosen“ sind nicht endgültig verstummt und werden es
nie sein.
Eine völlig andere Stimme eines einzelnen Menschen, die dennoch für sehr viele spricht, hören wir
im 5. Kapitel. James Field Stanfield hatte 1774-76 eine Sklavenfahrt von Liverpool nach Benin und
Jamaika und wieder zurück mitgemacht, einige Monate in einer Sklavenfaktorei im Binnenland
zugebracht und als Wanderschauspieler gearbeitet. Seine „Observations on a Guinea Voyage, in a
Series of Letters Adressed to the Rev. Thomas Clarkson“ wurden 1788 vom Londoner Komitee für
die Abschaffung des Sklavenhandels veröffentlicht. Er schrieb aus Sicht des einfachen Seemanns
und verstand das Ganze als eine „Kette ...., deren Erschütterung durch das ganze Reich der
Schmerzen schwingt“ (S. 192). Nicht erst das Schiff, schon gar nicht „Guinea“, wie die Händler die
gesamte westafrikanische Küste nannten, ist der Beginn des Elends, sondern das beginnt da, wo
sich die Kaufleute überlegen, wie sie am besten ihr Kapital vermehren können. Er beschreibt,
welche Tricks und Betrügereien nötig sind, damit ein Matrose auf einem Sklavenschiff anheuert,
wie es auf dem Schiff zugeht, ehe und nachdem die Sklaven an Bord sind, und wie deren Ankunft
vor sich geht. „Einer der Akteure in Stanfields Drama war der 'barmherzige' Sklavenhändler, dessen
Habsucht Raubgier, Zerstörung und Mord hervorbrachte. Das Morden war geplant: Er kalkulierte,
wie viele Menschen auf der 'Totenliste' stehen konnten, ohne dass sein Gewinn zu sehr geschmälert
wurde.“ (S. 211) Es ist nichts Persönliches, es ist rein geschäftlich!
Ein solcher barmherziger Sklavenhändler tritt dann im sechsten Kapitel auf. John Newton ist der
wahrscheinlich bekannteste Sklavenschiffskapitän, der zwischen 1748 und 1754 vier Fahrten
(davon eine nur als Steuermann) gemacht hatte. Er hatte aber auch einen riesigen Fundus an
Schriftstücken aus seiner aktiven Zeit hinterlassen, darunter alleine 127 Brief an seine Frau. Er
stammte aus einer Kapitänsfamilie und sein Vater hatte einigen Druck und Kniffe aufwenden
müssen, um ihn aufs Sklavenschiff zu bringen. Dort benahm er sich wie andere Kapitäne auch,
außer dass er recht bald mystisch fromm wurde und ab der dritten Fahrt täglich Gottesdienste auf
dem Schiff abhielt. Nachdem sein Schiff beinahe untergegangen war, aber samt Ladung gerettet
wurde, schrieb er „Amazing Grace“, verstand das Schiff als „Friedensreich“ und wurde nach Ende
seiner Seekarriere dann konsequenterweise auch Pfarrer. Er schloss sich aber erst über 30 Jahre
später, Ende der 1780-Jahre, der Abolitionistenbewegung an und sagte dann auch im Unterhaus
gegen die Sklaverei aus. Das Verdrängen des strukturell Bösen und das Sehen der individuellen
Gnade ist integraler Bestandteil der bürgerlichen Existenz bis heute, gelernt wurde es auf dem
Sklavenschiff.
Dass dies nicht notwendig bedeuten muss, dass die am strukturell Bösen Beteiligten ihr Tun nicht
auch genießen könnten, lernen wir im siebten Kapitel. Es untersucht die Rolle der Kapitäne auf dem
Sklavenschiff. Die wäre zunächst ohne das Kaufmannskapital gar nicht denkbar. Die Kaufleute
waren Eigner der Schiffe, nur in sehr seltenen Fällen hatten die Kapitäne Besitzanteile. Aber die
Kaufleute agierten im Sklavenhandel hauptsächlich als produktive Investoren. Ihre Investition
betraf Ladung und Schiff. Ein Teil der Ladung waren tatsächlich normale Handelsgüter, also
Handelskapital, die Sklaven aber waren Produktivkapital. Ich greife jetzt ein wenig auf das folgende
Kapitel vor, aber zum Verständnis ist es notwendig, hier schon den Vorgang kurz zu beschreiben.
Die Sklaven kommen als Menschen mit Geschichte, Tradition und Selbstbewusstsein an Bord und
müssen in den Amerikas als Plantagenarbeitskräfte abgeliefert werden. Dazu müssen sie aber erst
gemacht werden, indem das Schiff sozusagen die Fabrik und die Besatzung deren Arbeiter sind.
Damit das klappt, muss der Kapitän die Seeleute auf der Fahrt nach „Guinea“ dementsprechend
zurichten. Nach dem Verladen der Gefangenen produziert die Besatzung dann gemeinsam mit den
Offizieren aus diesem „Rohstoff“ die Ware Arbeitskraft. Damit das gelingt, müssen die Kapitäne
Macht ausüben, unter anderem indem „sie anderen Grausamkeiten und Leid zufügen ... mit anderen
Worten ... Terror“ (S. 286). „Dass Kapitäne eine derartige Macht besaßen, lag an der strategischen
Position, die sie in der schnell expandierenden, internationalen kapitalistischen Wirtschaft
einnahmen. Ihre Macht gründete sich auf die Gepflogenheiten der Seefahrt, aber auch auf die
Gesetze und die Sozialgeographie. Der Staat ermächtigte den Kapitän, körperliche Züchtigung
anzuwenden, um 'Unterordnung und Regelmäßigkeit' unter seiner Besatzung aufrechtzuerhalten,
während er die Märkte der Welt miteinander verband.“ (S. 254) Hinter der kapitalistischen
Ordnung, und erscheine sie noch so zivil, steht am Ende immer die Gewalt.
Aber jede Maschine funktioniert nur, wenn sie bedient wird. Und dazu braucht die „gewaltige
Maschine“ Schiff den Seemann. Und der will auf keinen Fall auf das Sklavenschiff, nicht weil er
etwas gegen die Sklaverei hat, sondern weil es ihm dort, wie wir aus dem Vorherigen wissen, noch
schlechter geht als auf anderen Handels- oder Kriegsschiffen. Aufs Sklavenschiff geht er nur, wenn
er gar keine andere Heuer findet, wenn er sofort irgendwo verschwinden muss oder wenn er
gezwungen wird. Auf dem Schiff herrscht unter den Leuten durchaus Solidarität und Freigebigkeit,
die harte Arbeit schweißt zusammen. Allerdings bleibt Befehl Befehl und wenn es verlangt wird,
übt der Seemann jede angesagte Gewalt aus, so wie er derselben seitens der Offiziere auch
regelmäßig ausgesetzt ist. Das Leben des Sklavenfahrers war nicht viel wert, etwa die Hälfte aller
Europäer, die meisten Seeleute, die im 18. Jahrhundert nach Westafrika fuhren, starb innerhalb eines
Jahres. Viele desertieren, manche rebellieren, gelegentlich gibt es Meutereien, ab und zu sogar
erfolgreiche. Beinahe hätte es sogar einen ganz großen Erfolg gegeben. Im August 1775 wurde in
Liverpool die Heuer für ein Sklavenschiff zum zweiten mal in kurzer Zeit gekürzt. Die Besatzung
zerschnitt die Takelage und verließ das Schiff. Einige wurden festgenommen und eingesperrt,
während sich die Nachricht blitzschnell im Hafen verbreitete. Viele weiter Besatzungen folgten dem
Vorbild, sie strichen (gewaltsam) die Segel ihrer Schiffe, auf Englisch „striked“, zogen mit ein paar
Tausend Leuten in die Stadt, griffen die Börse, wo nicht zuletzt Sklavenkapital gehandelt wurde,
mit Kanonen an und einige Sklavenkaufleute zuhause. Sie wurden von aus Manchester gerufenen
Dragonern besiegt, aber ihr Tun, das Streiken, ist uns bis heute erhalten geblieben, wenn auch die
Herrschaftsmittel der Gegenseite, hier die Takelage, nicht mehr gewaltsam zerstört und ihre
Gewaltmittel, hier Schiffskanonen, dabei leider nicht mehr angeeignet werden. Nebenbei, auch das
hat sich nicht geändert: Seeleute konnten auch eine schwarze Haut haben, aber dann waren sie
„weiße Männer“, wie die Afrikaner*innen ihre Quäler nannten.
Wie die auf dem Schiff lebten, kämpften und zugerichtet wurden, beschreibt das neunte Kapitel.
Die hier geschilderten Grausamkeiten sind kaum zu ertragen und machen das Lesen schwer. Es geht
darum, die Gefangenen möglichst rasch und gründlich sich selbst zu enteignen, ihnen eine neue
Ordnung aufzuzwingen, um ihre Körper zu objektivieren und als disziplinierte Arbeitskraft neu zu
sozialisieren (S. 352) Diesem „cultural stripping“ stand auf jedem Schiff zu jedem Zeitpunkt
Widerstand entgegen. Das war meistens extrem kompliziert, kamen die Versklavten doch oft aus
verfeindeten Gruppen, sprachen keine gemeinsame Sprache, hatten unterschiedliche Traditionen,
mit Unterdrückungen umzugehen, und waren allemal extrem traumatisiert. Und dennoch fanden
sich neue Kommunikationsformen, es entstanden allen verständliche Sprachen oder
Verhaltenscodes. Alles, was man sich an Gegenwehr nur denken kann, fand statt:
Nahrungsverweigerung, Selbstmord, individuelle Angriffe auf die weißen Männer, Aufstände,
Versenken des ganzen Schiffes. Ein Autor schätzt, dass mindestens auf jedem zehnten Schiff ein
kollektiver Aufstand stattfand; scheitere er, war es so schlimm auch nicht, besser tot als Sklaverei.
Und manche glaubten, dass die Toten zurückkehrten nach Guinea. So war „das mysteriöse
Sklavenschiff ... zu einem Ort des kreativen Widerstands für die Menschen geworden, die nun
herausfanden, dass sei 'Schwarze' waren, black folks. In einem dialektischen Prozess von
überwältigender Kraft brachte die unter Leid und Tod entstandene Gemeinschaft des Sklavenschiff
selbstbewusste, widerstandsfähige, lebensbejahende afroamerikanische und panafrikanische Kultur
hervor.“ (S. 397)
Und was machte das alles mit den Menschen „zuhause“, in Nordamerika und Großbritannien, die
nicht am Sklavenhandel verdienten? In den Häfen der „Neuen Welt“ sah man überall die Matrosen
herumliegen, die krank und arbeitsunfähig zurückgelassen wurden, ehe die Schiffe nach England
ablegten. Dort hatten kürzlich noch zahlreiche Menschen unter Bezug auf die Bibel gegen
„Sklavenhäuser“ rebelliert, hatten neue Gemeinschaften gegründet, waren ausgewandert. Marcus
Rediker hat das zusammen mit Peter Linebaugh im Buch über die „vielköpfige Hydra“
eindrucksvoll beschrieben. Bis weit in die 1780-Jahre war das Sklavenschiff eine von der
Wirklichkeit in den Heimatländern weit entfernte, abgetrennte Welt gewesen. Aber jetzt entstanden
Gruppen, die dagegen mobilisierten. Eines ihrer wichtigsten Mittel war, über die Zustände auf den
Schiffen aufzuklären. Als besonders wirksam erwies sich eine bildliche Darstellung eines
Sklavenschiffs, der Brooks. Sie war eines der größeren im Handel tätigen Schiffe und transportierte
regelmäßig mehr Sklaven, als es die Gesetzeslage zuließ. Die Abolitionskomitees in Plymouth und
London fertigten nacheinander mehrere weiterentwickelte Zeichnung an, die zeigten, wie eng und
unerträglich es für die Versklavten wäre, wenn auch nur die erlaubte Zahl an Bord wäre. Das wurde
mit einem erklärenden Text mehrfach in größerer Auflage gedruckt, auch in den USA, und hielt
allen Behauptungen der Sklavereibefürworter stand, es sei doch in Wirklichkeit alles ganz anders.
Fasst alle Informationen, die nötig gewesen waren, um so exakt zu arbeiten, hatten die
Abolitionisten von Männern bekommen, die auf den Schiffen gefahren waren und dort selbst
Grausames erlebt hatten. Es waren die „Deserteure, die Krüppel, die Rebellen, die Männer, die
ausgestiegen waren und die, die sich schuldig fühlten – kurz, die Renegaten, die den Sklavenhandel
von innen kannten und schockierende Geschichten darüber zu erzählen wussten“. „Werdet ihr
wirklich“, fragte ein Abgeordneter im Parlament von Westminster, „Eure Schiffslieger, Schiffsfeger
und Deckscheurer unseren Admirälen und Männern von Ehre entgegenstellen?“ (S. 426) Auch
diese Konstellation kennen wir bis heute.
Der Epilog betont, „dass die Erfahrung des Sklavenschiffs die Gefangenen nicht nur auf die
Sklaverei, sondern auch auf den Widerstand gegen die Sklaverei vorbereite. Sie entwickelten neue
Strategien des Überlebens und der gegenseitigen Hilfe, neue Formen der Kommunikation und der
Solidarität innerhalb großer multiethnischer Gruppen. Sie eigneten sich neues Wissen an: über das
Schiff, über die 'weißen Männer', übereinander, ihre Schiffskamerad*innen. Hier, auf dem Schiff – und das ist vielleicht das Wichtigste – lagen die Anfänge einer Kultur des Widerstand, der
subversiven Praktiken des Verhandelns und des Aufstands.“ (S. 460)
Wenn man das Buch gelesen hat, ist es schwer zu verstehen, wie man so lange so vieles übersehen
konnte, das offenkundig vom Schiff kommt. Wer sich die Schilderungen grauenhafter Gewalt, die
das Buch enthält, nicht zumuten möchte, sollte es trotzdem lesen und manche Passagen
überspringen. Diejenigen, die das alles erlebt haben, und ihre Nachkommen waren und sind damit
schließlich auch immer konfrontiert und eine echte Kommunikation mit ihnen wird für die „weißen
Männer“ nicht möglich sein, wenn sie das nicht zur Kenntnis nehmen.
Marcus Rediker
Das Sklavenschiff. Eine Menschheitsgeschichte
Assoziation A Berlin/Hamburg 2023
Download als PDF