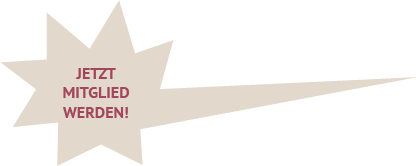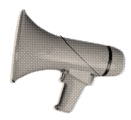Armut, soziale Ungleichheit und internationale Solidarität
Ina Schildbach: Armut verstehen
Philosophische Armutskonzepte
Einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Armut leistete Jean-Jacques Rousseau schon im 18. Jahrhundert: „Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen „Dies ist mein“ und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, ist der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft“ (18). Hätte man ihm nicht geglaubt, wären den Menschen viele Verbrechen, Kriege und Morde erspart geblieben. Der kenianische Philosoph Henry Odera Oruka ist Begründer einer neuen universalistischen Ethik: Jedes Mitglied der menschlichen Spezies, nicht nur als Bürger eines Staates, hat ein Recht auf ein menschliches Minimum. Überkonsum und ausschweifenden Genuss nennt er einen „dehumanisierenden Lebensstil“. Der neoliberale Ökonom Friedrich August von Hayek lehnt dagegen staatliche Bekämpfung von Armut ab. Armut lasse sich gemäß der neoliberalen Ideologie nur um den Preis der Freiheit bekämpfen. Thomas Pogge hält es dagegen für erforderlich, Armut als Verstoß gegen die Menschenrechte international zu bekämpfen. Ebenso sieht es Peter Singer. Papst Franziskus sieht Armut als Zeichen gesamtgesellschaftlicher und individueller moralischer Verkommenheit. Er meint: das Geld muss dienen, nicht regieren. Für die Verfasserin ist Armut nach Auswertung der unterschiedlichen philosophischen Stellungnahmen nicht nur ein Problem für die unmittelbar Betroffenen, sondern für Staat und Gesellschaft insgesamt.
Sozialwissenschaftliche Konzepte
In diesem Kapitel werden unterschiedliche Ansätze dargestellt.
- Ressourcenansatz: Armut ist Mangel an Mitteln wie Nahrung, Wohnen, Kleidung und medizinischer Versorgung.
- Lebenslagenansatz: Zusätzlich zum Einkommen werden hier auch Teilnahme an der Erwerbstätigkeit, Bildung, Wohnen und der materielle Lebensstandard berücksichtigt.
- Armut als Exklusion: Ausschluss aus sozialen Beziehungen bedeutet Monopolisierung von Chancen für diejenigen die an den Beziehungen teilhaben können.
- Der Capability Approach (Verwirklichungsansatz) von Amartya Sen stellt die Selbstentfaltung des Individuums in den Mittelpunkt. Armut ist deswegen nicht nur geringes Einkommen, sondern auch Mangel an Selbstverwirklichungschancen.
Armutsursachen
Von Armut betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringqualifizierte, Menschen mit Migrationshintergrund. Auch Kinderreichtum und Behinderung stellen Armutsrisikofaktoren dar. Armut entsteht in zahlreichen Politikfeldern: Wirtschafts-, Sozial-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik. Einen wesentlichen Beitrag zur Armut leisten die im Verhältnis zu Arbeitseinkommen gestiegenen Unternehmergewinne.
Armut von Staaten
Korruption kommt in armen Staaten weitaus häufiger vor als in wirtschaftlich weit entwickelten. Sie ist zugleich Ursache und Folge von Armut.
Kolonialismus hat die Staaten im Globalen Süden nicht nur in der Vergangenheit geprägt, sondern ist als Element von Abhängigkeit und Unterwerfung auch heute noch spürbar. Hervorzuheben ist hierfür vor allem die Rolle als Ressourcenlieferant, die bis heute sowohl zu einer Abhängigkeit von Endprodukten als auch zu mangelnder Technisierung und Industrialisierung geführt hat.
Übergeordnete Ursachen
Die imperiale Lebensweise bedeutet, dass die Staaten des Südens nicht nur durch Wirtschaftsinteressen des globalen Nordens ausgebeutet werden, sondern dass wir alle von dieser Ausbeutung zum Beispiel durch billige Produkte profitieren.
Einen wesentlichen Beitrag zur Benachteiligung der Länder des Globalen Südens leistet auch die Verlagerung der negativen Effekte der Produktion (z. B. Müll) in diese Länder durch Abwälzung von Kosten auf Außenstehende.
Armutsursachen und sozialökologische Transformation
Länder des globalen Südens fehlen häufig die Mittel, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen. Als Beispiele werden Bangladesch und die Niederlande genannt. Während letztere sich gegen den Meeresanstieg schützen können, fehlen Bangladesch hierfür die Mittel und viele Menschen sind schon jetzt zur Flucht vor Überschwemmungen gezwungen. Zur Bekämpfung von Armut dient ein gut funktionierendes Bildungssystem, das in den Ländern des Globalen Südens häufig nicht ausreichend vorhanden ist. Hinzu kommt der „Brain-Drain“, die Abwanderung von gut ausgebildeten Menschen in reiche Länder.
Global-staatliche Ansätze zur Bekämpfung von Armut
Eine weltweite Lohnuntergrenze würde die Armut mit einem Schritt beseitigen und zugleich den Wettbewerb um möglichst billige Arbeit begrenzen. Widerstände dagegen gibt es sowohl von weltweit agierenden Unternehmen als auch von Staaten, die sich ihre Standortvorteile wegen geringer Lohnkosten nicht nehmen lassen möchten. Eine Alternative wäre eine Jobgarantie innerhalb von Staaten, die allerdings in Zeiten von Migration ebenfalls schwer durchzusetzen ist. Eine weitere Maßnahme wäre das Bedingungslose Grundeinkommen. Auch hier sind die Widerstände so erheblich, dass es sich kaum durchsetzen lassen wird. Ein Schuldenerlass für arme Länder wäre ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von Armut, weil die staatlichen Gelder dann intern eingesetzt werden könnten. Ein weiterer Schritt wäre die Modifikation des internationalen Handelssystems. Ein zollfreier Handel z.B. nutzt vor allem den reichen Ländern. Diskutiert wird auch eine globale Staatsbürgerschaft, die zu weltweiter Reisefreiheit führen würde. Eine sich erheblich verstärkende Migration könnte allerdings auch zu einem Wettbewerb um gut bezahlte Arbeitsplätze führen, der dann zu einer Lohnminderung führen würde. Eine Erweiterung der globalen Staatsbürgerschaft wäre die Einführung eines Weltstaates, der einen weltweiten Mindestlohn einführen könnte. Dieses Konzept scheitert aber leider an den erheblichen weltweiten kulturellen Differenzen. Postwachstumskonzepte und sozial-ökologische Transformation sind für eine dauerhafte Ökonomie erforderlich, lassen sich aber nur durchsetzen, wenn der Nationalismus überwunden und dadurch die Konkurrenz abgebaut wird.
Anja Weiß/Nicolle Pfaff: Soziale und globale Ungleichheit
Soziale Ungleichheit in der Welt
Soziale Ungleichheit bedeutet nicht nur materielle Ungleichheit, sondern auch mangelnde Anerkennung für die Armen, die in der Regel beide gemeinsam auftreten. Sie werden über Institutionen wie das Bildungswesen verteilt und können deswegen nicht von einzelnen verändert werden. Wichtig ist hier die kulturelle Dimension, die Ungleichheit zu einer individuellen Verantwortung umdefiniert hat. Individualisierung und Neoliberalismus haben das Versprechen des Aufstiegs zu einer Verpflichtung werden lassen. Das Fördern wurde zum Fordern, Armut wird als Folge mangelnder individueller Anstrengung gewertet. Durch Qualifizierung im Bildungswesen soll Ungleichheit nicht aufgehoben, sondern legitimiert werden.
Ungleiche Verteilung
Wichtige Dimensionen für Ungleichheit sind Klasse und Stand. Marx hat gezeigt, dass Bourgeois und Arbeiter*innen sich nicht als gleiche gegenübertreten können - auch wenn sie rechtlich frei und politisch gleichgestellt sind. Die Einkommensungleichheit sowohl innerhalb als auch zwischen Ländern ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Eine gerechte Verteilung zwischen den Ländern könnte einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Armut leisten. Als Beispiel wird der Milliardär Elon Musk angeführt, der nur 2 % seiner Aktien verkaufen müsste, um 42 Millionen Menschen vor existenzbedrohendem Hunger zu retten. Einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Ungleichheit leisten die Steueroasen, in denen etwa 8% aller Privatvermögen angelegt sind.
Institutionalisierte Missachtung: von der Subkultur zur Intersektionalität
Cultural studies gehen deutlich über den Marxismus hinaus, der Klassenverhältnisse auf ökonomische Ungleichheit zurückführt. Neben der Ökonomie ist für diese Studien die Kultur ein entscheidendes Feld für die Austragung sozialer Kämpfe. Die Intersektionalität unterstreicht die gegenseitige Beeinflussung diskriminierender Kategorien. Neben der Klasse stehen Geschlecht, race und Behinderung im Mittelpunkt der Forschung. Zentrales Element insbesondere der Rassismusforschung ist das „Othering“, d.h. die Frage, wie Unterschiede erzeugt werden. Als Beispiel können Disability Studies angeführt werden für die nicht mehr der medizinische Begriff der Behinderung im Vordergrund steht, sondern wie Behinderung kulturell erzeugt wird. Man ist nicht behindert, sondern wird behindert. Auch ethnokulturelle Zugehörigkeiten werden konstruiert, wodurch symbolische Grenzen der Zugehörigkeit geschaffen werden. In der Schule können diese Konstruktionen zu Benachteiligungen und Ausschluss von Lerngelegenheiten führen. Eine diskriminierende Konstruktion ist auch das Label „bildungsfern“, weil es die Familie für schlechte schulische Leistungen der Kinder verantwortlich macht. Zutreffender wäre die Bezeichnung „Migrationsferne von Bildungsinstitutionen“, weil diese die institutionelle Verantwortung definiert.
Wer entscheidet über wen?
Am Beispiel indigener Schüler*innen in Kanada, deren Kultur in der Schule lange Zeit unterdrückt wurde, wird die Notwendigkeit der Mitsprache, der demokratischen Partizipation der Betroffenen verdeutlicht.
Sprachlosigkeit und Identitätspolitik
Identitätspolitik kann für Ausgeschlossene, die als Überflüssige oder Subalterne bezeichnet werden, eine sinnvolle Widerstandsbewegung sein. Als Beispiel wird die schwarze Bürgerrechtsbewegung angeführt, die in Großbritannien in den 1970er Jahren gegründet wurde. Identitätspolitik ist eine sinnvolle Antwort auf Sprachlosigkeit. Da jedoch häufig die Unterschiede in den eigenen Reihen eingeebnet werden, besteht die Gefahr, dass Prozesse des „Othering“ festgeschrieben werden. Identitätspolitik ist primär eine Frage der Solidarisierung. Die Betroffenen müssen sich zusammenschließen und Benachteiligungen und Diskriminierungen anzeigen. Sie sollten jedoch nicht die kategorischen Zuschreibungen wie Behinderung, ethnische Herkunft oder Geschlecht übernehmen, sondern ein sich dagegen wehren und für eigene Rechte und Bedürfnisse einstehen. Ungerechtigkeit ist kein Problem allein dieser benachteiligten Gruppen, sondern ein allgemeines gesellschaftliches Problem gegen das gemeinsame Solidarität erforderlich und möglich ist. Dies gilt nicht nur im nationalen Rahmen, sondern auch in globaler Perspektive.
Institutionelle Diskriminierung
Diskriminierung findet nicht nur auf persönlicher, sondern auch auf institutioneller Ebene statt. Eine Bielefelder Studie hat nachgewiesen, dass Migrantenkinder häufiger an schlechte Schulen verwiesen wurden, wenn es zu viele Schüler*innen gab. Eine andere wichtige Maßnahme zur Steigerung sozialer Ungleichheit ist die Abstandsvergrößerung, wenn Institutionen aus kleinen große Unterschiede machen. Unterschiede zwischen den Noten 2 und 3 im dritten Schuljahr können am Ende der Schulzeit zu Abitur und Realschulabschluss führen, die wiederum im Berufsleben zu massiven Einkommensunterschieden führen können.
Staatsbürgerliche Schließung und sozialräumliche Autonomie
Soziale Schließungen finden nicht nur zwischen sozialen Gruppen, sondern auch zwischen Nationen statt. Die Staatsbürgerschaft eines Kindes ist sehr viel entscheidender für seine Lebenschancen als Bildungsabschluss oder Beruf der Eltern. „Ein Bauarbeiter verdient in Berlin fast dreimal so viel wie eine Ärztin in Neu-Delhi und das auch dann, wenn man die Unterschiede in den Lebenshaltungskosten berücksichtigt“ (79). Die Unterschiede machen sich nicht nur bemerkbar, wenn Menschen in unterschiedlichen Heimatländern arbeiten, sondern auch, wenn sie die Grenzen überschreiten. Bekanntes Beispiel sind in Deutschland ausländische Menschen, die als 24-Stunden-Pflegekräfte arbeiten.
Von unterschiedlich hohen Löhnen in den Ländern des Globalen Nordens und des Globalen Südens profitieren nicht nur Unternehmen, sondern auch Konsument*innen. Als Beispiel führen die Verfasserinnen den Kaffeepreis in den USA an, der bei sieben Dollar pro Pfund liegt. Wenn die Arbeit zur Herstellung genauso hoch bezahlt würde wie in den Ländern des Nordens, müsste es 23,52 $ mehr kosten und bei 30 $ liegen.
Zusammenfassend stellen die Autorinnen fest: „Globale Ungleichheiten haben zur Folge, dass Staatsbürgerrecht ähnlich wie soziale Schließung privilegierter Klassen funktioniert“ (86).
Intervention: was bedeutet das für Schule und Politik?
Obwohl es mehr höhere Bildungsabschlüsse gibt, ist es nicht zu einer Entkoppelung zwischen Herkunft und Bildungsabschlüssen gekommen. Auch Schulen mit mehreren Bildungsabschlüssen anstelle von Haupt- und Förderschulen haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Die Zunahme von Privatschulen in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass es weiterhin Beharrungskräfte für die Aufrechterhaltung von Homogenität als Privileg gibt. Hintergrund ist die neoliberale Ideologie des eigenverantwortlichen Lernens, durch welche die strukturellen Ursachen von Ungleichheit verschleiert werden.
Zu den Ursachen der Beibehaltung von Ungleichheit zählt auch, dass bei Migrantenkindern die Ursache für Probleme nur in der Sprache statt in der Einkommensarmut aus zugewanderten Familien gesehen werden. Es sind jedoch nicht nur sprachliche Förderung, sondern auch sozialpolitische Maßnahmen gegen Armut und zur Verbesserung der Situation im Bildungswesen erforderlich. So müssen z.B. Schwimmbäder, Turnvereine und Musikschulen für alle Kinder zugänglich sein und mindestens für Bedürftige auch kostenlos.
Diskussion
Die beiden Bände zeichnen sich nicht nur durch viele Gemeinsamkeiten z.B. in der Notwendigkeit zur Entwicklung internationaler Solidarität in der Bekämpfung von Armut oder in der Beurteilung von Identitätspolitik aus, die einerseits als notwendig gesehen wird, um Sprachlosigkeit zu überwinden, andererseits aber auch Gefahren wie Entsolidarisierung mit anderen benachteiligten Gruppen hervorrufen kann.
Die zahlreichen Beiträge zur Förderung internationaler Solidarität und zur Schaffung eines solidarischen Systems der Weltwirtschaft sind nicht nur richtig für die Förderung einer friedlichen und gleichberechtigten Welt, sie sind auch ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Diskriminierung von Migrant*innen. Der häufig geäußerte Vorwurf, Flüchtlinge würden das deutsche Sozialsystem plündern, erweist sich als absurd, wenn man die ökonomische Benachteiligung der Länder des Südens in Betracht zieht. Von dieser Benachteiligung profitieren nicht nur Unternehmen, sondern auch Konsument*innen wie am Beispiel des Kaffeepreises gezeigt wurde. Ein anderes gerade in Deutschland bekanntes Beispiel ist die Produktion von Kleidungsstücken in asiatischen Ländern wie Bangladesch. Durch Einnahmen aus den deutschen Sozialsystemen können Migrant*innen aus dem Süden bestenfalls ein Minimum ihrer ökonomischen Ausbeutung kompensieren. Der Finanzminister des französischen Königs Ludwig XIV. hat diese merkantilistische Politik schon 1669 auf den Punkt gebracht: „Dieser Staat floriert nicht nur an sich, sondern auch durch die Not, die er allen Nachbarstaaten zugefügt hat.“ (Buchter 2025,18). Notwendig ist nicht nur eine international solidarische Wirtschaftspolitik wie sie von den Verfasserinnen beschrieben wurde, sondern auch eine Aufklärung der Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge und vor allem auch ihre Einbeziehung in die schulische Bildung.
Literatur
Buchter, Heike: Der Staat bin ich. Nicht nur in der Vorliebe für goldenen Prunk ähnelt US-Präsident Donald Trump dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV., sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Die Zeit, 28. 8. 2025, Seite 18
Schildbach, Ina: Armut verstehen. Wochenschau Verlag, Frankfurt/M 2024
Weiß, Anja/ Nicolle Pfaff: Soziale und globale Ungleichheit. Wochenschau Verlag, Frankfurt/M 2025
Download als PDF