|
EU, Wasser und das GATS
In der EU sind die drei weltmächtigsten Wasserkonzerne ansässig. Bekanntlich arbeiten Politik und Wirtschaft wunderbar zusammen. Was erzählen Konzerne und Politiker den vom Wasser abhängigen Weltbürgern und wessen Interessen vertreten die wirklich?
Europäische Wasserpolitik
EU, Wasser und das Dienstleistungsabkommen GATS
GATS-Verhandlungen
Direkte Wirkung von GATS auf Wasserversorgung
GATS – Die Rolle der EU
Europäische Wasserpolitik
Ohne Unterstützung durch die Europäische Regierung und der Kommission wäre die erfolgreiche weltweite Expansion europäischer Multis im letzten Jahrzehnt nicht denkbar gewesen. Sie basierte auf direkter politische Intervention wie in der Buenos Aires Konzession1, auf massivem Druck durch internationale Organisationen wie der Weltbanktochter „Internationale Finanzierungskooperation“ (IFC) sowie finanzieller Unterstützung durch die Europäische Entwicklungsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Letztere unterstützte allein in Osteuropa Konzessionen von Vivendi, Suez, RWE und Gelsenwasser mit Krediten an Gemeinden im Wert von mehreren 100 Mrd. € [17b].
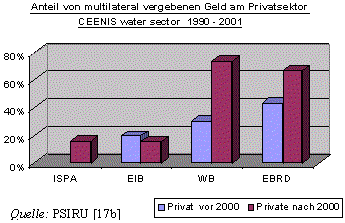 |
Nach dem Weltgipfel für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (WSSD) in Johannesburg wurde die EU Wasser Initiative initiiert. Mithilfe des Instruments der Private-Public-Partnership PPP soll unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe eine weitere Expansion europäischer Konzerne legitimiert werden. Der jüngste EU-Vorstoß ist der sog. Prodi-Water-Fund, ein vorgeschlagener 1-Mrd.-Fond. Diese „Entwicklungsgelder“ sollen ausschließlich für den Aufbau einer privatisierungsfreundlichen Administration in Entwicklungsländern dienen und Investoren den Markt öffnen. Vor dem G8-Gipfel in Evian scheiterte dieser Vorstoß, weil die Gelder aus dem Europäischen Entwicklungsfond umgeschichtet werden sollten, bei dessen Verwendung den AKP-Staaten ein Mitspracherecht zusteht.
EU, Wasser und das Dienstleistungsabkommen GATS
Das Abkommen über Handel mit Dienstleistungen (GATS)2 regelt den grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen (DLs). Das weitreichende Abkommen umfasst verschiedene „Sektoren“, u.a. Transport, Tourismus, Handel, Bildung, Banken & Versicherungen, medizinische & soziale Dienste (z.B. Krankenhäuser), und „Umweltdienstleistungen“. Letztere spaltet sich in Untersektoren auf, darunter die Müll- und Abwasserentsorgung. Aufgrund ökonomischer und ethischer Bedenken wurde die Trinkwasserversorgung in der Uruguay-Runde nicht Teil des GATS [GATS1].
Insgesamt umfasst das GATS ein dreimal höheres Handelsvolumen als das Güterverkehrsabkommen GATT. Es werden vier Modi unterschieden:
- der grenzüberschreitende Transfer von DLs wie Post, Telefon, Internet;
- der Konsum in einem anderen Land wie Tourismus oder Reparaturen;
- Regelungen über Filialen international agierender DL-Konzerne in anderen Ländern;
- Regelung über Personen, die DLs international anbieten [22].
Aufgrund seines wirtschaftlichen Umfangs hat Mode 3 besondere Bedeutung auch im Wassersektor.
GATS-Verhandlungen
Während der GATS-Verhandlungen fordern Länder voneinander die Liberalisierung einzelner Sektoren. Während dies theoretisch zum beidseitigen Vorteil führen sollte, haben bereits die Agrarverhandlungen gezeigt, dass Entwicklungsländer durch ein Machtungleichgewicht sowie die gegenseitige Konkurrenz um Märkte reicher Länder kaum Verhandlungsmacht haben und sich Interessen ihrer Eliten durchsetzten.
Die GATS-Verhandlungen sind mit einem Kuhhandel vergleichbar: Zunächst fragte jedes Land bei anderen Ländern an, ob diese bereit sind, bestimmte Dienstleistungssektoren dem Weltmarkt zu öffnen (requests). Danach machen Länder geheim Liberalisierungsangebote für bestimmte Sektoren (offers). Für Entwicklungsländer wirken sich bei diesem Prozeß die mangelnde Präsens am WTO-Sekreteriat in Genf sowie die wenigen nationalen Rechtsexperten negativ aus: Deutschland kann einige hundert Juristen sowie etliche Verhandler finanzieren, während die ärmsten Länder zusammen einen Verhandler für alle WTO-Abkommen stellen. Zudem „beraten“ Konzerne die Industrieländer mit viel Kostenaufwand.
Die Verhandlungen werden bei Dissensen in geschlossenen Green-Room-Sitzungen geführt, zu denen nur wichtige ELs wie Indien und Brasilien geladen werden. So kann von einer Gleichberechtigung der Länder innerhalb der WTO in der Praxis nicht gesprochen werden.
Am Ende einer Handelsrunde werden im sog. Single-Undertaking die noch offenen Punkte aller WTO-Abkommen (Agrarabkommen, GATS, Anti-Dumping, TRIPS) gegeneinander ausgehandelt, einem sehr schnellen, weitreichenden und nicht mit den Nationalparlamenten abstimmbaren Verhandlungsmarathon 3. Die Geheimverhandlungen sind in hohem Maße intransparent und man fragt sich, wieso – schließlich behauptet die WTO, das Wohl der Bürger zu vertreten...
Direkte Wirkung von GATS auf Wasserversorgung
Bis heute gab es noch keine WTO-Klage, die GATS-Regelungen zum Thema Wasser berührt. Dieses Argument nutzen GATS-Befürworter gerne, um Kritiker als Panikmacher zu delegitimieren. Die Frage, inwieweit GATS schon heute auf Wasserversorger wirkt, ist umstritten und muss mit Bezug auf die momentane Welle der Freihandelsidee überlegt werden.
In einer Landtagsanhörung in Hannover argumentierte ein pro-liberaler Landtagsabgeordneter, die Wasserverbände müssten schleunigst wettbewerbsfähig gemacht werden, um in liberalisierten Märkten wettbewerbsfähig zu sein. Auch internationale Expansionsfähigkeit in liberalisierten Märkten wurde als Begründung genannt [19]. Da kleine Unternehmen nicht stark genug für den Weltmarkt sind, sei das Zusammenlegen zu großen, kapitalstarken Konglomeraten nach dem französischen oder niederländischen Modell notwendig. GATS wird als „Schreckgespenst“ zur Durchsetzung eigener politischer Zielvorstellungen verwendet, als ob die jetzigen Verhandlungen schon abgeschlossen und unausweichliches Schicksal seien. So versetzt GATS im Wassersektor schon heute Berge.
Unter WTO-Gesetzen wie auch unter GATS gelten Grundprinzipien, die insbesondere Regierungen die „Inländerbehandlung“ vorschreiben: Kein ausländisches Unternehmen darf anders behandelt werden wie ein Nationales. Auch müssen Regierungen aufgrund der Notwendigkeitsklausel (Art. VI, GATS) nachweisen, das alle getroffenen Maßnahmen und Regulierungen „die am wenigsten handelsverzerrende Option darstellen“. Diese Forderung steht dem jetzigen Umweltrecht diametral entgegen, die einen vorsichtigen und nachhaltigen Umgang mit dem Wasserhaushalt vorschreibt. Das Vorsorgeprinzip ist die wichtigste Errungenschaft des Umweltrechts sowie des Verbraucherschutzes und besagt, dass im Falle von Unwissen und unter Unsicherheit Regierungen verpflichtet sind, vorsichtig und zum Wohle des Bürgers sowie der Umwelt zu handeln. Die Notwendigkeitsklausel des GATS dagegen schreibt vor, bei Unsicherheit zunächst den Interessen internationaler Konzerne Folge zu leisten. Das GATS ist hierarchisch höher angesiedelt als Bundes- und EU-Gesetzte und hat letztendlich Priorität.
Die Hauptgefahr des GATS liegt in seiner Grundzweck: der fortschreitenden Liberalisierung (GATS, Teil IV). Verhandlungen "finden danach regelmäßig statt, um schrittweise einen höheren Stand der Liberalisierung zu erreichen (Art. XIX)". Dieser Artikel wirkt zusammen mit dem Einbahnstraßenartikel XXI, der in (1,a) zwar erlaubt, "Verpflichtung jederzeit ändern oder zurücknehmen" zu können. Allerdings müssen dann mit allen betroffenen Ländern „Einigung über notwendige Ausgleichsmaßnahmen“ für entstandene Schäden ausgehandelt werden, und zwar auf Grundlage der entgangenen zukünftigen Gewinne, die Unternehmen beispielsweise durch ein Gesetz zum Arbeitsschutz entstehen – dramatische Forderungen, die aus der NAFTA und dem geplatzten Investitionsschutzabkommen MAI bereits in seinen Auswirkungen bekannt sind. Weil eine Liberalisierung nur im Falle einer konkreten Problemlage aufgehoben werden muss, ist ein de-liberalisierendes Land immer in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition und es kam in der Praxis noch nie zu solch einem Fall. Liberalisierungen im GATS sind de facto bindend, verfassungsändernd und unwiderruflich.
Bis 2000 unterlag nur die Abwasserentsorgung den GATS-Regelungen. Die höchst sensible Trinkwasserversorgung war ausgeklammert. Nun hat die EU, die mit RWE (BRD), Vivendi und Suez (F) die stärksten Unternehmen im Wasserversorgungsbereich hat, diese Grenze überschritten. Sie forderte von 72 Ländern, ihre Grenzen im Wasserbereich zu liberalisieren und macht so die Versorgung mit Trinkwasser zu einem neuen Subsektor der GATS-Verhandlungen unter dem Titel „Wasserförderung, -reinigung und -verteilung“ [GATS2].
Entwicklungspolitisch sehr erfolgreich waren einige dezentrale Projekte mit großer Partizipation der Bevölkerung 4. Beispielsweise würden die Forderungen an Bolivien und Brasilien („full market access commitment“) Regelungen illegalisieren, die Grundlage für Lateinamerikas erfolgreichste Wasserver- und Entsorger waren. So wurde nach dem Scheitern einer korrupten Regierung in Porto Alegre die starke Bevölkerungsbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben, um Misswirtschaft und Veruntreuung vorzubeugen. Die transparenten und partizipativen Kunden-Kooperative in Santa Cruz dämmte die Korruption erfolgreich ein, ihr wurde durch einer Weltbankstudie mit die beste ökonomischen Bilanz Lateinamerikas bestätigt [WELTBANK SANTA CRUZ].
Als „besondere Legalform“ verstoßen solche (erfolgreichen) Handelseinschränkungen gegen das GATS, da ausländischen Investoren keine Chancengleichheit gewährt wird. Damit nimmt das GATS vielen Kommunen die Hoheit über ihre eigene Daseinsvorsorge und macht selbstbestimmte Entwicklung unmöglich. Anstatt als Vorbilder für die Entwicklungszusammenarbeit drohen die GATS-Regelungen, solche seltenen Lichtblicke für immer zu verbieten.br>
Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), der agierende Arm des BMZs für Entwicklungsprojekte, versucht etwas verzweifelt, in schwachen Ländern den Aufbau staatlicher Regulierungsbehörden zu unterstützen. So soll ein politisches Gegengewicht zu privaten Konzernen im liberalisierten Dienstleistungsmarkt aufgebaut werden [20]. Leider haben schwache und mit Korruption durchsetzte Regierungen vieler Länder keine kulturell gewachsenen politischen Ethik, die in den goldenen Jahren der sozialen Marktwirtschaft bei uns Grundlage für die heute bröckelnden Arbeits- und Umweltstandards war - eine Ethik, die Basis für jede erfolgreiche staatliche Kontrolle ist. Auch GTZ-Mitarbeiter mit jahrelangem Auslandeinsatz wissen dies. Unter neoliberalem Druck durchs BMZ wird die GTZ momentan unstrukturiert und soll sich auf dem internationalen Markt der Entwicklungshilfe-Dienstleistungen mit Produkten wie der „Beratung zum Aufbau von Regulierungsbehörden“ profilieren und Public-Private-Partnerschaften fördern. Dabei wird nicht GATS-konforme Erfahrung bewusst vergessen.
Ein Konzern wie Vivendi hat zudem bessere Juristen des internationalen Wirtschaftsrechts und weiter reichende politische Hebel als kommunale Behörden. Selbst eine anfänglich gut ausgestattete Regulierungsbehörde wird langfristig zersetzt werden. Deutsche Entwicklungshilfe wurde so zum Wegbereiter der Privatisierung und Liberalisierung, ganz im Sinne der EU-Konzerne und der oben erwähnten Prodi-Vorschläge. Vom GATS profitieren nicht kleine Privatinitiativen wie Genossenschaften, Bürger-GmbHs oder dezentrale Kleinanlagenanbieter, denn diese haben keine Notwendigkeit zur internationalen Expansion. Statt dessen werden bürgerferne, investorennahe und international agierende Großkonzerne bevorteilt, deren Geschäftsziele schnelle Aktienausschüttungen, Marktdominanz und Machtausweitung sind.
GATS – Die Rolle der EU
Die bereits beschriebene Privatisierungspolitik der EU im Rahmen seiner Finanzinstitutionen spiegelt sich in den GATS-Verhandlungen wieder, innerhalb der die EU-Kommission die treibende Kraft bei der Liberalisierung des Wassersektors darstellt. In den durchgesickerten EU-GATS-Forderungen heisst es wörtlich: „European companies are world leaders in this sector, [...] and the main objective of the EC for the negotiations is to reduce the barriers which European operators face in third countries' markets“ [17d].
Während die Kommissionsvorschläge offiziell aus gemeinsamen Positionen aller Ministerien der Mitgliedsländern evolviert und dann im europäischen Rat der Wirtschaftsminister abgesegnet wird, liefert die Kommission in der Praxis fertige Entwürfe an die Wirtschaftsministerien und Industriebündnisse (z.B. BDI) . Deren Erweiterungswünsche werden eng mit der Industrie erarbeitet und im Rat der EU-Wirtschaftsminister als Paketlösung abgesegnet. Über Einwände aus anderen Ministerien und der Zivilgesellschaft kann mit dem Argument der „Rücksicht auf europäische Partner“ in dem intransparenten Entscheidungsprozess hinweggegangen werden. So schaffen Wirtschaftsministerien international Fakten und "lösen" nationale Meinungsverschiedenheiten wie die bereits erwähnte Differenz mit dem Umweltministerium in der Wasserliberalisierung. Diese Strategie verfolgen auch andere Ministerien mit internationalen Abkommen (Kyotoprotokoll, Biodiversitätsabkommen, Bio-Savety-Protoll), haben aber keine wirksamen Durchsetzungsmechanismen wie Strafzölle.
Gleichzeitig bildet sich momentan Widerstand in vielen EU-Ländern gegen Liberalisierung hierzulande. Intern scheint die EU tiefe Zerwürfnisse über dieses Thema zu haben und es zeichnet sich keine eindeutige Position ab, so dass noch Hoffung bleibt, dass die Trinkwasserversorgung bei uns aus dem GATS ausgeklammert bleibt, was mit den Liberalisierungsforderungen der EU ein böses Paradox zeigt. EU-intern haben die weltstärksten Konzerne bereits heute unbegrenzten Zugang zur Trinkwasserversorgung, soweit Nationalgesetze es zulassen. Für Länder der dritten Welt, in denen die Zivilgesellschaft dringendere und näherliegender Probleme als GATS hat, und auch für die USA besteht nach den EU-Forderungen keine Entwarnung, selbst wenn die EU ihren eigenen Markt weiter geschlossen halten sollte.
Verschiedene Auswirkungen auf das deutsche Wasserhaushaltsmanagement sind zu befürchten. So verstoßen das Minimierungsprinzip der Trinkwasserverordnung, welches die nach dem Stand der Technik niedrigste Schadstoffkonzentration vorschreibt, gegen das Notwendigkeitsprinzip ebenso wie das Minimierungsprinzip bei der Einleitung von Schadstoffen in Flüsse. Die Forderung nach „minimaler Handelsverzerrung“ des GATS legt „ökonomische“ Regelungen nahe: Amerikanische Firmen argumentieren innerhalb des WTO-Vorbilds NAFTA, Verschmutzung unter dem Verhältnis „Vermeidungskosten : Schadensrisiko“ zu bewerten. So ist eine Versorgung mit Flaschenwasser in manchen Regionen dem Umweltschutz aus ökonomischer Sicht vorzuziehen.
Die Befreiung kommunaler (nicht gewinnorientieter, sondern konstendeckend arbeitender) Versorger von der Mehrwertsteuer ist als GATS-konforme Bevorteilung einer bestimmten Legalform abzuschaffen. Auch das Örtlichkeitsprinzip 5, mit dem - wenn möglich - die Versorgung mit lokalen Wasserressourcen vorgeschrieben ist, wird hinsichtlich seiner „Notwendigkeit“ zu Konflikten mit dem GATS führen.
Thorsten Arnold
GRÜNE LIGA (Bundeskontaktstelle Wasser)
www.wrrl-info.de, www.UNSER-wasser.de
1 Dokumentiert ist die Freundschaft der Präsidenten Chirac und Menem mit dem Suez-Generaldirektor und Chirac-Parteispender Jérôme Monod. Nach Ende der Konzession wurde die Gewinnabführung von 100 Mio US$ an einen Protégé Menems kritisiert. Unter Korruptionsverdacht steht zudem Marie J. Alsogaray, die Vorsitzende der Regulierungsbehörde zur Einhaltung des Konzessionsvertrages und Tochter von Menems politischen Vater. Sie stimmte weitreichenden Nachverhandlungen des Vertrages zu und muss vor Gericht die Herkunft von Geldern und Wohnungen im Wert von einigen Millionen US$ darlegen [17c]. 2 Dieses WTO-Abkommen steht unter www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm im Netz. Auch wird eine englischsprachige Einführung in das GATS-Abkommen geboten, in der das WTO-Sekreteriat ausdrücklich beschreibt, das internationale Konzerne genau den gleichen Beschränkungen unterliegen müssen wie lokale Initiativen. Eine deutsche Fassung des GATS ist unter www.ich-bin-gats.de verlinkt. 3 Im Single Undertaking werden beispielsweise Zugeständnisse von EU/USA im Agrarabkommen angeboten, die für ELs sehr wichtig sind. Dafür hatten sich diese bereits in der abgeschlossenen Uruguayrunde bereiterklärt, das GATS mit in den Prozeß aufzunehmen. Da die Industrieländer nach wie vor ihre Agrarmärkte geschlossen halten und auch massive Exportsubventionen in die jetzige Doha-Runde gerettet haben, bieten sie nun den Zugang zu unseren Agrarmärkten gegen die Aufnahme „neuer Themen“ in die WTO-Verhandlungen an, zu denen ein Investitionsschutzabkommen ähnlich dem gestoppten MAI und weitreichende Wettbewerbsforderungen gehören [20]. 4 Siehe beispielsweise das Orangi-Projekt, Pakistan, oder Porto Alegre, Brazilien. 5 Nach Wasserhaushaltsgesetz WHG, Novelle VII. |



