|
Wasserprivatisierung unter der Lupe
Nach der 2. unbezahlten Mahnung vom Wasserwerk den Hahn abgedreht bekommen? Was kümmert’s die Wassermultis. Kein Horrorszenario, sondern alles schon vorgekommen und auch bei uns vielleicht bald ganz normal.
Vom Allgemein- zum Wirtschaftsgut
Investitionsbedarf
Steigende Preise
Berlin – das Tor zu lukrativen Märkten in Osteuropa
Wasser an der Börse
Wasserprivatisierung und GATS
Vom Allgemein- zum Wirtschaftsgut
Wo auch immer auf dieser Welt Trink- und Abwasserversorgungen an Privatfirmen verkauft oder für Jahrzehnte abgetreten werden - das Online-Nachrichten-Magazin „Wasser kaufen“ hält die Entscheider rund um die Uhr auf dem neuesten Stand. Der gesamte Markt, Unternehmen, Personalien und natürlich die Börsennachrichten im Wassermarkt können hier täglich aktualisiert verfolgt werden. Nur für zahlende Leser, versteht sich.
Dass Nachrichtenmagazine wie „Wasser kaufen“ oder auch die ebenfalls nur zahlungskräftigen Kunden Auskunft gebende britische Zeitschrift „global water intelligence" überhaupt eine Leserschaft finden, weist auf einen erschreckenden Trend hin: Die lebensnotwendigste aller Ressourcen wird vom Allgemein- zum Wirtschaftsgut – obwohl sich doch das Menschenrecht auf Wasser unmittelbar aus dem Artikel 11 des Internationalen Pakts für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt, seit 1976 in Kraft, UN 1996) ableitet und jedem Menschen den allgemeinen, gerechten und nicht diskriminierenden Zugang zu gesundem Wasser gewährleistet.
Von 6 Milliarden Menschen haben noch immer 1,7 Milliarden keinen Zugang zu Trinkwasser und über 3 Milliarden Menschen (jeder zweite) nur begrenzten Zugang zu sanitären Einrichtungen. Demzufolge sterben täglich fast 30.000 Menschen an Krankheiten, die mit einem Mangel an Trinkwasser oder sanitären Einrichtungen zusammenhängen.
Die Ressource Trinkwasser ist zu einem knappen Gut geworden – und damit für private Investoren das Gold des 21. Jahrhunderts. Es wird davon ausgegangen, dass bis ins Jahr 2015 bereits 1,16 Mrd. Menschen Kunden privater Wasseranbieter sein werden. Die internationalen Konzerne sind inzwischen auf allen Kontinenten aktiv. Da der Löwenanteil der Wasserversorgung in kommunaler Hand liegt, ist das geschätzte Volumen des noch privatisierbaren Marktes enorm hoch und liegt je nach Schätzung irgendwo zwischen $400 Mrd. und $3 Billionen.
Die starke Verschuldung von Drittweltländern und Kommunen wird seit den 90ern verwendet, um die Privatisierung dieser Dienstleistungen zu fordern. Durch den Verkauf der kostendeckend arbeitenden Betriebe der öffentlichen Hand sollen Schulden beglichen werden. Auch Effizienzgewinne und günstigere Tarife werden versprochen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass Privatinvestoren nur an den ohnehin besser laufenden Staatsbetrieben interessiert sind.
Im Zuge der oben erwähnten Gewinnmaximierung können Einnahmen durch Gebührenerhöhungen gesteigert und Kosteneinsparungen realisiert werden. Bei „Rationalisierung“, also Arbeitsplatzvernichtung, wurde vielfach bei der Qualitätskontrolle sowie den Instandhaltungsmaßnahmen gespart, wie die hohen Prozesszahlen gegen Wasserversorger beim Privatisierungsvorreiter England sichtbar machen. Dort schreckten die privaten Wasserversorger auch nicht davor zurück, tausenden von Bürgern, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen konnten, den Hahn abzudrehen.
Investitionsbedarf
Wegbereiter und Hauptfinanzier im Wassersektor ist inzwischen die Weltbank. In den letzten 12 Jahren wurden Kredite in Höhe von $ 20 Mrd.(das ist rund 1/6 der von der Weltbank vergebenen Kredite) an Wasserprojekte vergeben, die im zunehmendem Maße an Privatisierungsauflagen geknüpft wurden. Aus einer Studie des ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) geht hervor, daß von 276 Krediten der Weltbank für Wasserversorgung 30% die Privatisierung voraussetzten. Gemeinsam befinden sich IWF und Weltbank hier in einer mächtigen Position: Der IWF kann die Privatisierung als Vorbedingung für neue Kredite und Schuldenerlaß festschreiben und bei Kreditabkommen von den Empfängerländern die Schaffung der Rahmenbedingungen für Privatisierungen verlangen. Im Anschluß wird durch Weltbankfinanzierung die Umstrukturierung umgesetzt und den Wasserkonzernen der Weg in den Wassersektor der Länder des Südens geebnet.
600 Milliarden Dollar, so schätzt die Weltbank, müssten in den nächsten zehn Jahren investiert werden, um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung allein in den Entwicklungsländern sicherzustellen. Für viele krisengebeutelte Staaten, Städte und Kommunen ein Ding der Unmöglichkeit.
Leider konzentriert sich das Betätigungsfeld der Konzerne in den Entwicklungsländern fast ausschließlich auf die Trinkwasserversorgung in urbanen Gebiete, v.a. auf wohlhabendere Wohngebiete in den riesigen Metropolen des Südens (z.B. Jakarta, Manila, Buenos Aires). Da die Wasserversorgung ländlicher Gebiete (wo die meisten Menschen ohne Wasserzugang leben) für private Anbieter unprofitabel ist, scheint in diesem Bereich kaum eine Verbesserung der Situation in Sicht. Auch die Übernahme der Abwasserversorgung in den ärmeren Ländern, erscheint bisher unattraktiv.
Steigende Preise
Von einer Privatisierung erhoffen sich viele eine Preissenkung. Ob diese Rechnung auch wirklich aufgeht, ist fraglich. Das zeigt sich am Beispiel der Berliner Wasserbetriebe, die zu 49,9% teilprivatisiert wurden und mit 3,7 Millionen Kunden die größten Wasserversorger Europas sind. Ein Konsortium aus dem französischen Wassergiganten Vivendi sowie den deutschen Unternehmen RWE und Allianz teilen sich den Kuchen. Dadurch flossen 3,3 Milliarden Mark in die maroden Kassen des Bundeslands. Gleichzeitig ist nun die private Firma für die Investitionen zuständig.
Der Wasserpreis ist gemäß Verkaufsvertrag nur für die ersten Jahre eingefroren. Ab 2004 hat das Konsortium endlich wieder freie Hand und wird auch sofort die Wasserpreise um 15 – 20 % erhöhen.
Berlin – das Tor zu lukrativen Märkten in Osteuropa
Berlin wurde mit einem neuen Stern am Forschungshimmel belohnt. Die Berlinwasser Unternehmensgruppe und Veolia Water (ehem. Vivendi Paris) haben in Kooperation mit der TU Berlin und kräftiger Finanzierung des Landes Berlin diese „unmittelbar gemeinnützige [Gesellschaft] im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" (Zitat: www.kompetenz-wasser.de) gegründet, eine Public Private Partnership. Die BW-Unternehmensgruppe gehört zu gleichen Anteilen Violia und RWE, sodass Violia im Aufsichtsrat die größte Fraktion stellt.
Ziel ist die Initiierung von Forschungsvorhaben, Mittelbeschaffung, das Stellen einer Komunikationsplattform im Wassersektor, und die Durchführung von Tagungen. Tatsächlich werden hier also die Wissenschaftler im Wasserbereich durch eine „gemeinnützige“ Firma versammelt und finanziert, die dem größten und drittgrößten Wasserkonzern der Welt dienen: Vivendi-Violia und RWE.
Berlin gilt in der Wirtschaft als Tor zu Osteuropa. mit seinen vielen lukrativen Märkten, deren Eroberung unser Kanzler bereits als Wachstumsmotor deklarierte. Dabei warnten in der Bundesrepublik die Regierungsfraktionen im Herbst 2001 in ihrem Antrag für eine „Nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland“ (Drs. 14/7177) vor einer Liberalisierung des deutschen Wassermarktes, denn eine Öffnung sei „ein Experiment mit ungewissen Folgen im Hinblick sowohl auf Umwelt- und Gesundheitsschutz als auch Preisentwicklung.“
Wasser an der Börse
Dass private Wasserversorger keine Wohltätigkeitsorganisationen sind, liegt auf der Hand: Denn das Geschäft mit dem „Blauen Gold“ soll sich rentieren.
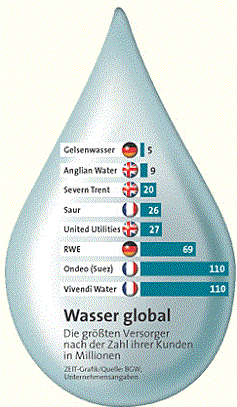 |
Die Voraussetzungen dazu sind gut, da es sich beim Wasser um ein natürliches Monopol handelt. Pro Stadt oder Region kann nur ein Versorger tätig sein - mehrere Wassernetze machen ökonomisch keine Sinn. Heute hängen bereits 110 Millionen Menschen an den Wasserhähnen des Branchenleaders Suez Lyonnaise des Eaux. Die Firma hat Städte wie Budapest, Casablanca oder Ho-Chi-Minh-Stadt unter Vertrag. 100 Millionen Kunden versorgt die Nummer zwei im Geschäft, die ebenfalls französische Vivendi.
Folgerichtig hat die Bank Pictet den weltweit ersten Wasser-Aktienfonds lanciert, der in 40 Wasserfirmen investiert. Der Pictet Water Fund entwickelte sich bereits innerhalb der ersten zwei Jahre erheblich besser als der MSCI World (Morgan Stanley Capital Index) und erfuhr innerhalb der ersten 18 Monate eine Wertsteigerung von über 30 %.
Die US-amerikanische Avalon Trust Company hat ihren Wasserfonds im Interesse ihrer Shareholder schon wieder vom Markt genommen. Begründet wird dieser Schritt mit den bestehenden regulatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Schon zu Beginn der Auflegung befürchtete die Avalon Trust Company, dass die Politik die Privatisierung nicht unterstützen würde. Dabei bemühen sich besonders EU-Politiker im Rahmen der GATS (Global Agreement on Trade in Services)-Verhandlungen, diese Hürden durch nationale Gesetze abzuschaffen. Damit stünde den Wassermultis dem Geschäft mit dem „Blauen Gold“ nichts mehr im Wege.
Wasserprivatisierung und GATS
Das GATS ist hierarchisch höher angesiedelt als Bundes- und EU-Gesetzte und hat letztendlich Priorität. Bis 2000 unterlag nur die Abwasserentsorgung den GATS-Regelungen. Die höchst sensible Trinkwasserversorgung war ausgeklammert. Nun hat die EU, die mit RWE, Vivendi und Suez die weltweit stärksten Unternehmen im Wasserversorgungsbereich hat, diese Grenze überschritten. Sie forderte von 72 Ländern, ihre Grenzen im Wasserbereich zu liberalisieren und macht so die Versorgung mit Trinkwasser zu einem neuen Subsektor der GATS-Verhandlungen unter dem Titel „Wasserförderung, -reinigung und -verteilung“.
Nicht kleine Privatinitiativen wie Genossenschaften, Bürger-GmbHs oder dezentrale Kleinanlagenanbieter profitieren von der fortschreitenden Privatisierung im Wassersektor, denn diese haben keine Notwendigkeit zur internationalen Expansion. Statt dessen werden bürgerferne, investornahe und international agierende Großkonzerne bevorteilt, deren Geschäftsziele schnelle Aktienausschüttungen, Marktdominanz und Machtausweitung sind.
Verschiedene Auswirkungen auf das deutsche Wasserhaushalts-management sind zu befürchten. Unter WTO-Gesetzen wie auch unter GATS gelten Grundprinzipien, die insbesondere Regierungen die „Inländerbehandlung“ vorschreiben: Kein ausländisches Unternehmen darf anders behandelt werden wie ein nationales. Es wird geschätzt, dass von den derzeit rund 6000 Wasserversorgern in Deutschland im Zuge der Privatisierung und Liberalisierung des Wassermarktes nur noch 150 übrig bleiben werden. Die dann zu erwartende Verschlechterung der Wasserqualität und der Anstieg der Preise wird dann ergänzt durch Arbeitsplatzverluste und somit noch weniger Geld in den Taschen der zu versorgenden Menschen.
Auch müssen Regierungen aufgrund der Notwendigkeitsklausel (Art. VI, GATS) nachweisen, dass alle getroffenen Maßnahmen und Regulierungen „die am wenigsten handelsverzerrende Option darstellen“. Diese Forderung steht dem jetzigen Umweltrecht diametral entgegen, die einen vorsichtigen und nachhaltigen Umgang mit dem Wasserhaushalt vorschreibt. Das Vorsorgeprinzip ist die wichtigste Errungenschaft des Umweltrechts sowie des Verbraucherschutzes und besagt, dass im Falle von Unwissen und unter Unsicherheit Regierungen verpflichtet sind, vorsichtig und zum Wohle des Bürgers sowie der Umwelt zu handeln. Die Notwendigkeitsklausel des GATS dagegen schreibt vor, bei Unsicherheit zunächst den Interessen internationaler Konzerne Folge zu leisten.
Liberalisierungen im GATS sind de facto bindend, verfassungsändernd und unwiderruflich und zementieren die Macht internationaler Multis gegenüber den Verbrauchern – bei der Trinkwasserversorgung ein Schreckensszenario.
Jana Martinetz
Attac GATS-Kampagne
Quellen:
Thorsten Arnold (2003), Wasserverknappung und Globalisierung: Privatisierung, Liberalisierung, GATS
Lisa Stadler (2000), Das Geschäft mit dem „Blauen Gold“, Kommunalmagazin 10/00
Public Citizen (2003), Corporate Profile: RWE/Thames Water, www.citizen.org/documents/RWEProfile2003.pdf
David Hall (2001), UK water privatisation – a briefing, www.psiru.org/reportsindex.asp
|